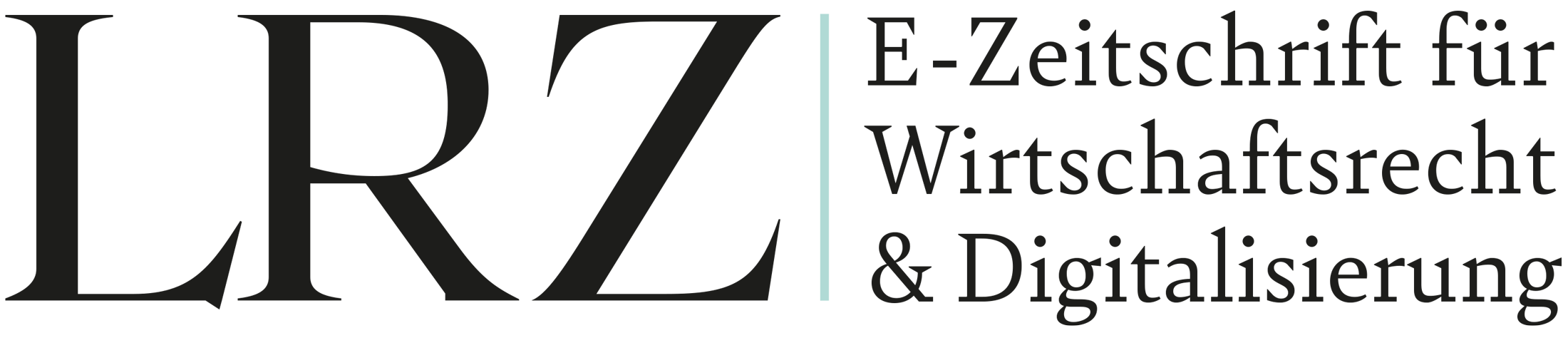Sprache auswählen

Umweltwerbung nach der Richtlinie zur Stärkung der Verbraucher für den ökologischen Wandel – Relevante Änderungen für werbende Unternehmen

- Dr. Constantin Eikel
- Partner, Kanzlei Bird & Bird

- Daniel Jakob
- juristischer Mitarbeiter, Kanzlei Bird & Bird
Zitiervorschlag: Eikel/Jakob, LRZ 2024, Rn. 460, [●], www.lrz.legal/2024Rn460.
Permanente Kurz-URL: LRZ.legal/2024Rn460
Der „Green Deal“ der Europäischen Union (EU) und die Omnipräsenz von Umweltwerbung hat die EU zur strengeren Regulierung motiviert. Das Ergebnis sind die bereits in Kraft getretene Richtlinie zur Stärkung der Verbraucher für den ökologischen Wandel und die noch nicht in Kraft getretene Richtlinie über Umweltaussagen. Die jüngste Richtlinie zur Stärkung der Verbraucher wird erheblichen Einfluss auf die Werbung mit Nachhaltigkeitssiegeln, allgemeinen Umweltaussagen, „Neutralitäts“-Aussagen (wie: CO2-Neutral) und Werbung mit zukünftigen Zielen (wie: bis 2030 werden wir klimaneutral sein) haben. Dieser Beitrag beleuchtet die praktischen Implikationen und Hintergründe der Richtlinie zur Stärkung der Verbraucher und gibt einen Ausblick auf die Richtlinie über Umweltaussagen.
- 1. Einführung (Hintergrund und Anwendungsbereich)
- 2. Neue per-se Verbote
- 3. Ergänzung der allgemeinen Irreführungsverbote und Informationspflichten
- 4. Ausblick und Einordnung
1. Einführung (Hintergrund und Anwendungsbereich)
Am 26. März 2024 trat die EU-Richtlinie zur Stärkung der Verbraucher für den ökologischen Wandel1 („Empowering Consumer Directive“, im Folgenden: EmpCo-Richtlinie) in Kraft. Bis zum 27. März 2026 müssen nun die Mitgliedstaaten die Regelungen der Richtlinie in nationales Recht umgesetzt haben. Die nationalen Gesetze und Regelungen sollen dann ab dem 27. September 2026 Anwendung finden.
Die EmpCo-Richtlinie ist dabei nur ein Baustein eines umfangreichen Maßnahmenpakets zur Umsetzung des „Green Deal“, der europäischen Strategie zur Erreichung des Ziels der Klimaneutralität bis zum Jahr 2050. Die Regelungen der EmpCo-Richtlinie sollen im Wettbewerbsrecht und insbesondere im Bereich der Umweltwerbung von der Richtlinie über Umweltaussagen („Green Claims Directive“) flankiert werden, über deren Vorschlag (im Folgenden: Green-Claims-Richtlinien-V) aktuell noch vom EU-Parlament und Rat verhandelt wird.2
Durch diese Regelungen soll die Position der europäischen Verbraucher weiter gestärkt werden, da ein hohes Verbraucher- und Umweltschutzniveau als Grundvoraussetzung identifiziert wurde, um zu einem reibungslosen Funktionieren des Binnenmarktes beizutragen und Fortschritte beim ökologischen Wandel zu erzielen. Deshalb sollen auch im Rahmen von Umweltwerbung unlautere Geschäftspraktiken stärker bekämpft werden, die Verbraucher in die Irre führen und verhindern, dass diese informierte und nachhaltige Konsumentscheidungen treffen; damit soll auch die Nachfrage und das Angebot von nachhaltigeren Waren und der Wettbewerb um solche Waren angekurbelt werden.3 Hinsichtlich der Umweltwerbung ergänzt die EmpCo-Richtlinie dabei die bisherigen Regelungen der Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken4 (im Folgenden: UGP-Richtlinie). Dabei werden einerseits die Vorschriften des Art. 6 und 7 UGP-Richtlinie zum Irreführungsverbot angepasst und andererseits einige Geschäftspraktiken in die Liste der per-se Verbote im Anhang I der UGP-Richtlinie aufgenommen (die sog. „schwarze Liste“).
Die EmpCo-Richtlinie gilt – auf Grund der UGP-Richtlinie – in erster Linie für Handlungen gegenüber Verbrauchern (d.h. B2C). Trotzdem werden die Regelungen der EmpCo-Richtlinie auch eine gewisse Relevanz für Handlungen gegenüber Unternehmen (d.h. B2B) haben. So wenden einige Mitgliedstaaten manche der Regeln für B2C-Werbung auch auf B2B-Werbung an, wobei sie dem für Geschäftskunden maßgeblichen Referenzunternehmer einen höheren Grad an Aufmerksamkeit zugestehen.5 Zudem wird die EmpCo-Richtlinie auch praktische Auswirkungen auf den B2B-Handel haben: Wenn ein B2B-Verkäufer gegenüber einem B2B-Käufer seine Produkte mit Umweltaussagen bewirbt, wird der B2B-Käufer beim Weiterverkauf an B2C-Käufer erwarten, dass er die Umweltaussagen wiederholen kann, die der ursprüngliche B2B-Verkäufer selbst gemacht hat.
2. Neue per-se Verbote
Durch die EmpCo-Richtlinie wurden einige Verhaltensweisen im Zusammenhang mit Umweltwerbung in den Anhang I der UGP-Richtlinie aufgenommen und damit als spezifische irreführende Geschäftspraktiken identifiziert, die unter allen Umständen als unlauter gelten und deshalb verboten sind.
2.1. Verbot allgemeiner Umweltaussage
Die neue Nr. 4a des Anhang I der UGP-Richtlinie6 stellt strenge Anforderungen an „allgemeine Umweltaussagen“ (auch bekannt als „generische Umweltaussagen“ oder „generic claims“). Die Benutzung einer allgemeinen Umweltaussage wird das Vorliegen sogenannter „anerkannter hervorragender Umweltleistung“ erfordern, auf die sich die Aussage bezieht.
Der Erwägungsgrund (9) der EmpCo-Richtlinie nennt Beispiele für allgemeine Umweltaussagen, wie „umweltfreundlich", „umweltschonend", „grün", „naturfreundlich", „ökologisch", „umweltgerecht", „klimafreundlich", „umweltschonend", „CO2-freundlich", „energieeffizient", „biologisch abbaubar" und „biobasiert“.7 Da die Liste dieser Beispiele nicht abschließend ist, hängt es vom jeweiligen Einzelfall ab, ob eine Umweltaussage als „allgemein“ zu klassifizieren ist.
Wird die Umweltaussage jedoch auf demselben Medium klar und hervorgehoben spezifiziert,8 handelt es sich aller Wahrscheinlichkeit nach nicht um eine allgemeine Umweltaussage. Spezifizierung meint eine detaillierte Darstellung der Hintergründe der umweltbezogenen Aspekte. Das ist eine wichtige Weichenstellung: Das Verbot „allgemeiner Umweltaussagen“ soll also nur greifen, wenn dem Verbraucher kein Kontext und keine Spezifizierung zur Verfügung gestellt wird. Wird Spezifizierung zur Verfügung gestellt, handelt es sich um eine „ausdrückliche Umweltaussage“ im Sinne der Green-Claims-Richtlinien-V und fällt damit unter die dortigen Regeln, sofern die Richtlinie erlassen wird. Trotz des dann insoweit eröffneten Anwendungsbereichs der Green-Claims-Richtlinien-V finden aber weiterhin die allgemeinen Regeln der UGP-Richtlinie Anwendung.9
Wird eine Umweltaussage als allgemein eingestuft, muss eine „anerkannte hervorragende Umweltleistung“ vorliegen, die für die Aussage relevant ist und die allgemeine Umweltaussage rechtfertigt. Der Nachweis anerkannter hervorragender Umweltleistung kann zum Beispiel durch das EU-Umweltzeichen (Verordnung Nr. 66/2010), durch staatlich anerkannten Systeme für Umweltkennzeichnung nach EN ISO 14024 oder durch ein Entsprechen mit Umwelthöchstleistungen für ein bestimmtes ökologisches Merkmal nach anderem gültigen Unionsrecht nachgewiesen werden, beispielsweise Klasse A im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1369.10 Kurz gesagt: Es müssen offizielle oder zertifizierte Kriterien erfüllt werden.
Darüber hinaus sollten Gewerbetreibende darauf achten, dass sich die anerkannt hervorragende Umweltleistung nicht nur auf Teilaspekte, sondern auf die gesamte Werbeaussage bezieht.
Schließlich: Gemäß Erwägungsgrund 10 der Richtlinie sollen Begriffe wie „bewusst“, „nachhaltig“ oder „verantwortungsbewusst“ nicht nur umweltbezogene Aspekte, sondern auch soziale Aspekte umfassen. Die EU rät – jedenfalls im Erwägungsgrund 10 – daher davon ab, diese Begriffe zu benutzen, wenn sie „nur“ mit anerkannter hervorragender Umweltleistung gerechtfertigt werden.11 In der Praxis kommt es wohl auf den Kontext an, ob diese Begriffe in der konkreten Verwendungssituation auch soziale Aspekte umfassen.
2.2. Verbot nicht relevanter Umweltaussagen
Nach der neuen Nr. 4b des Anhang I der UGP-Richtlinie12 sind Umweltaussagen zum gesamten Produkt oder zur gesamten Geschäftstätigkeit des Gewerbetreibenden verboten, wenn sich die Umweltaussagen tatsächlich nur auf einen Teilaspekt des Produkts oder einen nicht repräsentativen Teil der Geschäftstätigkeit beziehen. Durch dieses Verbot sollen Gewerbetreibende dazu angehalten werden, den Umweltaspekt ihres Produkts oder ihrer Geschäftstätigkeit nicht übertrieben darzustellen. Die mit diesem Verbot angegriffene Praxis übertriebener Umweltwerbung ist schon auf Grund der aktuellen Regeln des UWG unlauter. Ein explizites Verbot über die schwarze Liste wird jedoch wahrscheinlich zu noch schärferer Durchsetzung führen. Zusätzlich zeigt die Rechtsvergleichung, dass die Praxis übertriebener Umweltwerbung bisher nicht in allen Mitgliedstaaten verfolgt wird, was wohl auch ein Grund für diese neue und explizite Regelung ist.
2.3. Verbot bestimmter Umweltwerbung bei Treibhausgaskompensationen
In der neuen Nr. 4c des Anhangs I der UGP-Richtlinie13 wird ein Verbot von Aussagen eingeführt, wonach ein Produkt (d.h. Waren und Dienstleistungen) hinsichtlich der Treibhausgasemissionen neutrale, verringerte oder positive Auswirkungen auf die Umwelt hat, wenn diese Aussagen auf der Kompensation von Treibhausgasen beruhen. Der häufigste Anwendungsfall dieser Regelung dürften CO2-Kompensationen sein.
Werbung mit Aussagen wie „klimaneutral“, „zertifiziert CO2-neutral“, „CO2-positiv“, „mit Klimaausgleich“, „klimaschonend“ und „mit reduziertem CO2-Fußabdruck“ sind nur noch zulässig, wenn diese nicht (auch) auf Kompensationen beruhen, sondern auf tatsächlichen Reduzierungen der Auswirkungen im Lebenszyklus des Produkts. Wenn die Aussagen hingegen (auch) auf dem Ausgleich von Emissionen (im Englischen: „Offsetting“) beruhen, wird – so die EU – bei den Verbrauchern der falsche Eindruck erweckt, der Verbrauch des Produkts habe keine Auswirkungen auf die Umwelt.
Dies stellt gerade international agierende Unternehmen, die eine global ausgerichtete, einheitliche Werbestrategie verfolgen wollen, vor Herausforderungen. Hier wird eine regionale Anpassung der Werbung notwendig werden, da viele Länder außerhalb der EU immer noch die für Unternehmen attraktive Neutralitätswerbung für Produkte auf der Grundlage von Kompensationen zulassen. Auch in Deutschland wurde in der Rechtsprechung bisher differenziert und nur bestimmte Klimaprojekte wurden für einen CO2-Ausgleich als ungeeignet bewertet.14 Das pauschale Verbot dürfte also in der Praxis große Auswirkungen haben.
Einige Fragen bleiben aber weiterhin offen: Fällt „Carbon Capture“ und „Carbon Removal“ auch unter diese Regelung? Diese auch als „CO2-Abscheidung und -Speicherung“ bekannte Technologie entfernt CO2 entweder aus der Umwelt (an einem beliebigen Ort) oder direkt an den Quellen fossiler CO2-Emissionen. Hier wird tatsächlich CO2 entfernt und dauerhaft gespeichert, aber nicht zwingend direkt im Lebenszyklus des Produkts. Die englische Sprachfassung der EmpCo-Richtlinie verwendet mit „Offsetting“ einen Begriff, unter den theoretisch auch „Carbon Capture“ und „Carbon Removal“ gefasst werden können.
In einer Pressemitteilung des Europäischen Parlaments15 zur Green-Claims-RL-V wird angedeutet, dass die überarbeitete (noch nicht veröffentlichte) Fassung der Green-Claims-RL-V ebenfalls Regelungen zur Werbung mit CO2-Gutschriften treffen wird. Wie genau diese neuen Regelungen aussehen werden, bleibt abzuwarten.
2.4. Verschärfung bei der Verwendung von Nachhaltigkeitssiegeln
Es gelten nun auch deutlich strengere Anforderungen bei der Verwendung von Nachhaltigkeitssiegeln. Die neue Nr. 2a des Anhangs I der UGP-Richtlinie16 wird künftig das Verwenden von Nachhaltigkeitssigeln verbieten, welche nicht auf einem „Zertifizierungssystem“ beruhen oder nicht von staatlichen Stellen festgesetzt wurden.
2.4.1. Nachhaltigkeitssiegel
Die Richtlinie definiert ein Nachhaltigkeitssiegel als ein “freiwilliges öffentliches oder privates Vertrauenssiegel, Gütezeichen oder Ähnliches, mit dem Ziel, ein Produkt, ein Verfahren oder eine Geschäftstätigkeit in Bezug auf ihre ökologischen oder sozialen Merkmale oder beides hervorzuheben oder zu fördern, ausgenommen alle verpflichtenden Kennzeichnungen gemäß Unionsrecht oder nationalem Recht“.17
Die Reichweite dieser Definition und damit auch der strengen neuen Regelung ist nicht eindeutig. Aus dem Gesetzgebungsverfahren ist bekannt, dass bildlich dargestellte Siegel adressiert werden sollten: Bäume, Wassertropfen, Blätter, Weltkugeln o.ä. sind beliebte Symbole, um in der Form eines Siegels etwaige Umweltaspekte zu bewerben. Unter die vorgenannte Definition lassen sich jedoch auch Worte (und Wortmarken) fassen, da diese ein „Vertrauenssiegel, Gütezeichen oder ähnliches“ sein können, welches „ökologische Merkmale hervorhebt oder fördert“. So werden auch im Erwägungsgrund (7) der Richtlinie explizit Gewährleistungsmarken als ein Beispiel für Nachhaltigkeitssiegel in Bezug genommen. Diverse Gewährleistungsmarken sind als Wortmarken registriert,18 was ebenfalls vermuten lässt, dass auch Worte theoretisch ein Nachhaltigkeitssiegel sein können. Dies hat erheblichen Einfluss auf Kategorie- oder Produktnamen. Wenn ein Unternehmen seine umweltfreundlicheren Produkte mit einem Schlagwort kategorisiert (z.B. „Conscious Choice“) oder bestimmte nachhaltige Materialien mit einem Schlagwort versehen werden (z.B. „Made with Rhino, our recycled material“), könnte dies – jedenfalls nach der Definition – bereits ein Nachhaltigkeitssiegel sein.
Dagegen könnte der mutmaßliche Wille des Gesetzgebers sprechen: Die Regelungen zu Nachhaltigkeitssiegeln sind auf eine Studie der EU zurückzuführen, die zu dem Schluss kam, dass zu viele Nachhaltigkeitssiegel auf dem Markt und viele davon irreführend sind.19 In dieser Studie wird allerdings klar zwischen Logos/Siegeln („logo/label“) einerseits und Text („text“) andererseits unterschieden.20 Vor diesem Hintergrund könnten die Definition so verstanden werden, dass zwischen einem Nachhaltigkeitssiegel („sustainability label“) und bloßen Wortzeichen zu unterscheiden ist.
Zudem wird in den Erwägungsgründen der Richtline als Beispiel für Nachhaltigkeitssiegel der Begriff „Logo“ genannt, welcher ein visuelles Element impliziert.21 Auch an anderen Stellen in der Richtlinie, beispielsweise in der englischen Legaldefinition einer Umweltaussage, ist der Begriff „label“ durch die Auflistung der Darstellungsformen von graphischen Elementen oder Symbolen („graphic or symbolic representation, such as labels“)22 mit visueller Kommunikation verknüpft.
Auch wenn gute Gründe dafürsprechen, dass Wortmarken nicht von den neuen Regelungen zu Nachhaltigkeitssiegeln umfasst sind, ist angesichts des breiten Wortlauts Vorsicht geboten. Vollständige Klarheit werden hier wohl nur die Gerichte bringen können.
2.4.2. Voraussetzungen und Anwendungsbereich
Sofern es sich um ein Nachhaltigkeitssiegel handelt, darf es nur noch benutzt werden, wenn es entweder von staatlichen Stellen festgesetzt wurde oder auf einem „Zertifizierungssystem“ beruht.
Das Zertifizierungssystem wird die einzige Möglichkeit sein, nicht-staatliche Nachhaltigkeitssiegel in der Werbung zu nutzen. Gleichzeitig soll durch die Einführung des Zertifizierungssystems aber erschwert werden, dass Unternehmen eigene Nachhaltigkeitssiegel benutzen.
Ein Zertifizierungssystem ist ein System, in dem Siegelnutzer (d.h. der Werbende), Siegelinhaber und Siegelprüfer voneinander rechtlich unabhängige Personen sind.23 Damit entsteht ein Dreieck an Personen: Der unabhängige Siegelprüfer (z.B. ein Sachverständige) überprüft, ob die Voraussetzungen erfüllt sind. Der unabhängige Siegelinhaber erteilt sodann dem Unternehmen die Erlaubnis, das Siegel zu benutzen. Damit wird es für Unternehmen nicht mehr möglich sein, Nachhaltigkeitssiegel selbst zu erstellen und auch zu benutzen. Vielmehr werden es wohl Verbände sein, die Siegel für alle ihre Mitglieder erstellen und betreiben.24
Daneben muss das Zertifizierungssystem unter transparenten und fairen Bedingungen für alle Gewerbetreibenden offen sein und dessen Anforderungen müssen in Absprache mit einschlägigen Sachverständigen und Interessenträgern ausgearbeitet werden.25
Wegen der sehr weiten Definition eines „Nachhaltigkeitssiegels“, die jedes grafische Symbol und ggf. Text erfassen könnte, besteht erheblicher Anpassungsbedarf bei vielen Unternehmen, um nicht gegen diese neuen Regelungen zu verstoßen.
2.5. Werbung mit gesetzlichen Vorgaben
Auch ist es nun in Nr. 10a des Anhang I der UGP-Richtlinie untersagt, mit Anforderungen für ein Produkt als besondere Unterscheidungsmerkmale zu werben, die bereits kraft Gesetzes für alle Produkte in der betreffenden Produktkategorie auf dem Unionsmarkt gelten.
Auch wenn einige Mitgliedstaaten diese Regel bereits jetzt anwenden und auch nach dem deutschen UWG die Werbung mit Selbstverständlichkeiten regelmäßig als irreführend angesehen wird,26 ist zu erwarten, dass das neue per-se-Verbot insbesondere im Hinblick auf die zukünftig geplante ESG-Regulatorik an Bedeutung gewinnen wird. So wird die geplante Verordnung über die umweltgerechte Gestaltung nachhaltiger Produkte („Ecodesign for Sustainable Product Regulation“) der EU die Befugnis verleihen, zusätzliche Anforderungen und Mindeststandards für Haltbarkeit, Reparierbarkeit, Energieeffizienz und Recycling von Produkten einzuführen.27 Dieser gesetzliche Mindeststandard darf in Folge der Neuregelung dann nicht mehr als ein besonderes Unterscheidungsmerkmal beworben werden.
3. Ergänzung der allgemeinen Irreführungsverbote und Informationspflichten
Neben diesen per-se Verboten ohne Wertungsmöglichkeit wurden durch die EmpCo-Richtlinie auch einzelne Regelungen der UGP-Richtlinie ergänzt, die Geschäftspraktiken betreffen, die auf Grundlage einer Einzelfallbewertung als irreführend gelten können.
3.1. Für die Irreführung wesentliche Merkmale
Zunächst wurde die Liste der für die Bewertung einer Irreführung wesentlichen Merkmale eines Produkts in Art. 6 Abs. 2 lit. b der UGP-Richtlinie um für Umweltaussagen relevante Faktoren ergänzt. Als Bezugspunkte für mögliche Irreführungen wurden ausdrücklich ökologische und soziale Merkmale sowie Zirkularitätsaspekte wie Haltbarkeit, Reparierbarkeit oder Recyclingfähigkeit aufgenommen. Für Deutschland sind die praktischen Auswirkungen dieser Änderung allerdings offen, da die deutschen §§ 5, 5a, 5b UWG bereits sehr offen formuliert sind und auch die neu eingeführten Aspekte bisher schon darunter gefasst werden können. Gleichwohl wird eine explizite Aufnahme dieser Aspekte möglicherweise zu einer erhöhten Wahrnehmung führen.
3.2. Aussagen über künftige Umweltleistungen
Nach dem neuen Art. 6 Abs. 2 lit. c der UGP-Richtlinie28 erfordern Aussagen über „künftige Umweltleistungen“ die Veröffentlichung klarer, objektiver, öffentlich einsehbarer und überprüfbarer (Selbst-)Verpflichtungen, die in einem detaillierten und realistischen Umsetzungsplan festgelegt sind, der regelmäßig von einem unabhängigen externen Sachverständigen überprüft wird, und dessen Erkenntnisse Verbrauchern zur Verfügung gestellt werden.
Dabei ist zu beachten, dass der Umsetzungsplan messbare und zeitgebundene Ziele sowie weitere relevante Elemente umfasst, die zur Unterstützung seiner Umsetzung erforderlich sind, wie die Zuweisung von Ressourcen. Außerdem soll der unabhängige Sachverständige über Erfahrungen und Kompetenzen in Umweltfragen verfügen.
Diese Änderung wird eine Vielzahl von Unternehmen zur Anpassung zwingen. Denn aktuell wirbt fast jedes Unternehmen mit Ambitionen und Zielen (z.B.: „Bis 2030 werden wir klimaneutral sein!“), wohl auch, weil es zu solcher Werbung bisher kaum Rechtsprechung gibt. Das ist auch der EU aufgefallen, die nunmehr objektive und messbare Zwischenziele verlangt, deren Einhaltung überprüft wird.
3.3. Werbung mit irrelevanten Vorteilen
Nach Art. 6 Abs. 2 lit. e der UGP-Richtlinie29 kann eine Geschäftspraxis auch als irreführend gelten, wenn mit Vorteilen für den Verbraucher geworben wird, die irrelevant sind und sich nicht aus dem Merkmal des Produktes oder der Geschäftstätigkeit ergeben. In diesen Fällen könnten Verbraucher sonst zu der fälschlichen Annahme verleitet werden, dass die Produkte oder Geschäftstätigkeiten für die Verbraucher, die Umwelt oder die Gesellschaft vorteilhafter sind als andere Produkte oder Geschäftstätigkeiten.30
3.4. Wesentliche Informationen bei Produktvergleichen
Schließlich werden in Art. 7 Abs. 7 der UGP-Richtlinie31 noch die Informationspflichten von Anbietern von Produktvergleichen verschärft. Wenn dem Verbraucher bei solchen Vergleichen Informationen über ökologische oder soziale Merkmale oder über Zirkularitätsaspekte wie Haltbarkeit, Reparierbarkeit oder Recyclingfähigkeit der Produkte oder der Lieferanten dieser Produkte bereitgestellt werden, werden Informationen über die Vergleichsmethode, die betreffenden Produkte und die Lieferanten dieser Produkte sowie die bestehenden Maßnahmen, um die Informationen auf dem neuesten Stand zu halten, als wesentliche Informationen angesehen. Durch diese Regelung soll sichergestellt werden, dass Produktvergleiche objektiv sind und dass dies in der Folge zu einer besser informierten Verbraucherentscheidung führt.32
4. Ausblick und Einordnung
Die EmpCo-Richtlinie wird Umweltwerbung innerhalb der EU grundlegend ändern. Zum Teil wird kritisch angemerkt, dass die einzelnen Nachbesserungen etwas unstrukturiert und kleinteilig wirken,33 und gerade die relativ offenen Definitionen der “allgemeinen Umweltaussage“ und der „Nachhaltigkeitssiegel“ werden bis zur gerichtlichen Klärung für Rechtsunsicherheit sorgen. In jedem Fall sollten Unternehmen kritisch überprüfen, welche ihrer Umweltaussagen (sei es in der Werbung, auf Verpackung oder gar auf Produkten) am 27. September 2026 noch auf dem Markt verfügbar sein werden. Sofern die Möglichkeit besteht, dass Umweltaussagen zu besagtem Stichtag noch auf dem Markt kommuniziert werden, sollte die EmpCo-Richtlinie bereits heute ausgiebig geprüft werden.
Sowohl das Zusammenspiel mit dem Green-Claims-Richtlinien-V als auch überhaupt die Notwendigkeit, gleich zwei Richtlinien zum gleichen Thema zu erlassen, werden in der Wirtschaft kritisch betrachtet. Der Green-Claims-Richtlinien-V wird für Unternehmen zukünftig mindestens genauso wichtig werden wie die EmpCo-Richtlinie. Der Green-Claims-Richtlinien-V schafft dabei einen selbstständigen Regelungskomplex, der von den durch die EmpCo-Richtlinie geänderten Vorschriften der UGP-Richtlinie grundsätzlich unabhängig ist.
Der Green-Claims-Richtlinien-V enthält detaillierte Regelungen über den Inhalt und die Form von ausdrücklichen Umweltaussagen. Im Gegensatz zum ex-post Ansatz der UGP-Richtlinie, der bei Vorliegen einer irreführenden Aussage eingreift, setzt der Green-Claims-Richtlinien-V auf einen ex-ante Ansatz zur Kontrolle von Informationen vor der kommerziellen Nutzung von Umweltaussagen: Dazu muss das Unternehmen die Umweltaussage zunächst anhand eines Katalogs von Mindestkriterien begründen (Art. 3, 4 Green-Claims-Richtlinien-V) und von einem Prüfer verifizieren lassen (Art. 19, 11 Green-Claims-Richtlinien-V).34 Erst nach dieser Verifizierung dürfen die Umweltaussagen den Verbrauchern gegenüber kommuniziert werden. Auch diese Richtlinie wird dementsprechend erneut erheblich in die unternehmerischen Gestaltungsmöglichkeiten von Umweltwerbung eingreifen.