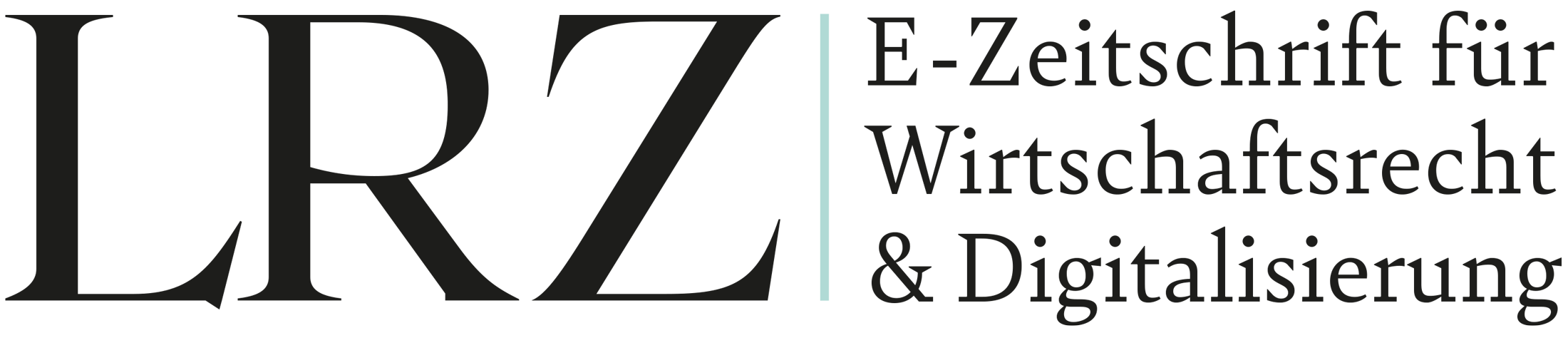Sprache auswählen

Nachhaltige Zuschlags- und Wertungskriterien im Vergabeverfahren

- Daniela Ariane Kreuels
- Rechtsanwältin, Heuking Kühn Lüer Wojtek

- Johannes Baumann
- Rechtsanwalt, Heuking Kühn Lüer Wojtek
Zitiervorschlag: Kreuels/Baumann, LRZ 2023, Rn. 764, [●], www.lrz.legal/2023Rn764.
Permanente Kurz-URL: LRZ.legal/2023Rn764
Das Vergaberecht stellt öffentlichen Auftraggebern einen breiten Werkzeugkasten zur Verfügung, um nachhaltig zu beschaffen. Umweltbezogenen Eignungs- und Zuschlagkriterien kommt dabei – inzwischen – eine besondere Bedeutung zu.
- 1. Einführung
- 2. Umweltfreundliche nachhaltige Beschaffung
- 3. Entwicklung nachhaltiger Eignungs- und Zuschlagskriterien
- 4. Grüne Eignungs- und Zuschlagskriterien
- 4.1. Umweltbezogene Eignungskriterien
- 4.2. Umweltbezogene Zuschlagskriterien
- 5. Grenzen
- 6. Fazit und Ausblick
1. Einführung
Das Vergaberecht stellt öffentlichen Auftraggebern einen breiten Werkzeugkasten zur Verfügung, um nachhaltig ihren Beschaffungsbedarf zu decken. Nachdem umweltbezogene Eignungs- und Zuschlagkriterien lange Zeit als unzulässige, „vergabefremde“ Kriterien galten, sind öffentliche Auftraggeber heute weitgehend frei, diese Kriterien im Vergabeverfahren zu berücksichtigen.
Dieser Artikel stellt im Überblick die vergaberechtliche Entwicklung der umweltfreundlichen nachhaltigen Beschaffung sowie die Berücksichtigungsfähigkeit von nachhaltigen Eignungs- und Zuschlagskriterien dar, erläutert im Einzelnen mögliche „grüne“ Eignungs- und Zuschlagskriterien sowie die Grenzen der Entscheidungsfreiheit, die öffentliche Auftraggeber bei der Festlegung der Kriterien zu beachten haben.
2. Umweltfreundliche nachhaltige Beschaffung
Öffentliche Aufträge machen in Deutschland ca. 15 Prozent des Bruttoinlandprodukts aus.1 Der jährlicher Wert von öffentlichen Aufträgen in Deutschland beträgt schätzungsweise 350 bis 500 Milliarden Euro. Ein Großteil der öffentlichen Aufträge entfällt auf Vergaben im Unterschwellenbereich.2 Dabei handelt es sich um die Aufträge, deren geschätzter Wert unterhalb der Schwellenwerte für europaweitere Vergaben nach § 106 GWB liegt. Solche Aufträge unterfallen nicht dem EU-Vergaberecht und sind nicht europaweit auszuschreiben.
Die Vergabe öffentlicher Aufträge spielt eine entscheidende Rolle, damit die öffentliche Hand ihre hohen Nachhaltigkeitsziele erreichen kann. Denn kaufen Bund, Länder und Kommunen nicht nur günstig, sondern auch nachhaltig ein, können sie viel bewegen. Erklärtes, unter anderem in der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie3 gesetztes Ziel ist eine umweltorientierte Beschaffung („Green Public Procurement“). Die Europäische Kommission definiert dies als Prozess, „in dessen Rahmen die staatlichen Stellen versuchen, Güter, Dienstleistungen und Arbeitsverträge zu beschaffen, die während ihrer gesamten Lebensdauer geringere Folgen für die Umwelt haben als vergleichbare Produkte mit der gleichen Hauptfunktion.”4
Das Vergaberecht stellt mit dem GWB und den darauf basierenden Verordnungen5 einen breiten Werkzeugkasten zur Verfügung, damit öffentliche Auftraggeber die benötigten Waren, Dienst- und Bauleistungen nachhaltig und umweltorientiert beschaffen können. Auch für Vergaben unterhalb der Schwellenwerte können öffentliche Auftraggeber auf allen Stufen des Vergabeverfahrens diese Aspekte berücksichtigen. Andere Gesetze – außerhalb der klassischen Vergabegesetze6 – und Verwaltungsvorschriften auf Bundes- und Landesebene7 enthalten weitere umweltbezogene Anforderungen, die beispielsweise die Bedarfsermittlung8 oder die Berücksichtigung von Lebenszykluskosten9 betreffen.
Bei der Auswahl des Beschaffungsgegenstandes sind öffentliche Auftraggeber weitestgehend frei. Sie können sich entscheiden, nur solche Produkte und Dienstleistungen zu erwerben, die beispielsweise bereits ressourcenschonend produziert wurden. Zwei weitere Stellschrauben des Vergaberechts, um einen Fokus auf nachhaltige Beschaffungen zu legen, sind umweltbezogene Eignungs- und Zuschlagskriterien. Sie ermöglichen öffentlichen Auftraggebern einerseits, umweltbezogene Kriterien schon bei der Auswahl der für den Auftrag in Frage kommenden Unternehmen zu berücksichtigen. Zudem können und dürfen öffentliche Auftraggeber auch bei Wertung von Angeboten Umweltkriterien festlegen und diese heranziehen, um das wirtschaftlichste Angebote zu ermitteln und auf dieses gemäß § 127 Abs. 1 Satz 1 GWB den Zuschlag zu erteilen.
3. Entwicklung nachhaltiger Eignungs- und Zuschlagskriterien
Mittlerweile ist es anerkanntes und ausdrückliches politisches Ziel,10 dass öffentliche Auftraggeber bei der Vergabe von Aufträge Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen. Das war allerdings nicht immer so; das Vergaberecht verfolgte ursprünglich primär das Ziel, Korruption zu vermeiden und Haushaltsmittel sparsam zu verwenden.11 Zudem sollten einheitliche europäische Vorgaben einen gemeinsamen Binnenmarkt schaffen. Um dieses Ziel zu erreichen, entstand durch ein einheitliches europäisches Vergaberecht ein europäischer Wettbewerb zwischen Unternehmen, in das nicht unmittelbar preisbezogene Parameter keinen Eingang fanden. So galten umweltbezogene Aspekte lange als „vergabefremde“ Kriterien, die Auftraggeber bei der Verfahrensgestaltung und ihrer Beschaffungsentscheidung nicht berücksichtigen durften.12
Durch geänderte politische Zielsetzungen, aber auch geprägt durch die Rechtsprechung des EuGH hat sich dieses Verständnis im Laufe der letzten 20 Jahre wesentlich gewandelt.13 Der Gerichtshof stellte mit seiner Entscheidung Concordia Bus Finland14 klar, dass öffentliche Auftraggeber Umweltschutzkriterien berücksichtigen dürfen, um zu ermitteln, welches Angebot am wirtschaftlichsten ist. Der EuGH stellte als wesentliche Voraussetzungen hierfür heraus, dass zwischen den umweltbezogenen Kriterien und dem Auftragsgegenstand ein Zusammenhang bestehen muss, mithin umweltbezogene Kriterien also nicht willkürlich festgelegt werden dürfen. Zudem betonte der EuGH die Notwendigkeit, dass Auftraggeber die Zuschlagskriterien hinreichend bekannt machen müssen.
Kurze Zeit später, in der Wienstrom-Entscheidung15, stellte der EuGH darüber hinaus klar, dass der öffentliche Auftraggeber die Zuschlagskriterien nicht nur frei auswählen, sondern die Gewichtung der einzelnen Zuschlagskriterien nach eigenem Ermessen festlegen darf, sofern die Gewichtung eine Gesamtwürdigung der Kriterien ermöglicht, um das wirtschaftlichste Angebot zu ermitteln.
Auch politisch gewann das Ziel, umweltfreundlich zu beschaffen, eine immer größere Rolle. Im Jahr 2008 stellte die EU-Kommission in der Mitteilung „Umweltorientiertes Öffentliches Beschaffungswesen“16 das ehrgeizige Ziel auf, dass innerhalb kurzer Zeit – nämlich bis zum Jahr 2010 – mindestens die Hälfte aller öffentlichen Auftragsvergaben in der EU umweltfreundlich sein und den gemeinsam mit den Mitgliedstaaten entwickelten „Green Public Procurement (GPP)“-Kriterien entsprechen sollen. Auch wenn dieses Ziel zwar nicht erreicht wurde, so blieb die Idee hierzu gleichwohl erhalten.
In der Folge setzte sich der Trend der Rechtsprechung des EuGH fort. In der Max Havelaar/Eko-Entscheidung17 setzte sich der EuGH im Jahr 2012 mit der Bedeutung von Gütezeichen auseinander und entschied, dass öffentliche Auftraggeber von Unternehmen den Nachweis verlangen dürfen, dass sie in Bezug auf den Auftragsgegenstand umweltorientiert arbeiten. Der EuGH betonte dabei, dass Gütezeichen zulässig sind, sofern sich diese auf die Eigenschaften des Produktes selbst beziehen und die ausgeschriebene Leistung technisch spezifizieren. Nicht zulässig ist hingegen das Anknüpfen an die allgemeine Geschäftspolitik des Bieters ohne Bezug auf den Auftragsgegenstand.
Im Rahmen der GWB-Novelle 2014 fanden schließlich nachhaltigkeitsorientierte, soziale- und umweltpolitische Belange endgültig Eingang in die Normen des europäischen Vergaberechts.18
Auch gesetzliche Neuerungen auf nationaler Ebene der letzten Jahre legen einen klaren Fokus auf einen nachhaltigen öffentlichen Einkauf. Beispielsweise verpflichtet das Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) den Bund zu prüfen, wie er bei der Beschaffung dazu beitragen kann, die nationalen Klimaschutzziele zu erreichen.19 Auch das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) ist aufgrund seiner Relevanz für umweltfreundliche Beschaffungen bei Vergaben zu beachten. Danach sollen Unternehmen, die ihren Sorgfaltspflichten nicht ausreichend nachkommen, von der Vergabe öffentlicher Aufträge ausgeschlossen werden.20 Das LkSG schützt zwar im Schwerpunkt die Einhaltung von Menschenrechten, führt jedoch in seinem Anhang auch zwei umweltrelevante Abkommen auf, die Unternehmen verpflichtend einhalten müssen. Dabei handelt es sich um das Minamata-Übereinkommen über Quecksilber21 und die POP-Konvention über persistente organische Stoffen22. Verstoßen Unternehmen nachweislich gegen diese Abkommen, sind sie nach § 22 Abs. 1 LkSG vom Vergabeverfahren auszuschließen. Abzuwarten bleibt, ob das derzeit im Trilog verhandelte Lieferkettengesetz auf europäischer Ebene über die dargestellten Anforderungen hinaus weitere Verpflichtungen aufstellt, umweltbezogene Kriterien im Vergabeverfahren zu berücksichtigen.
4. Grüne Eignungs- und Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Ausführungen geben einen kurzen Überblick über mögliche „grüne“ Eignungskriterien sowie Zuschlagskriterien.
4.1. Umweltbezogene Eignungskriterien
Öffentliche Auftraggeber können mit umweltbezogen Kriterien festlegen, welche Unternehmen sie als geeignet erachten, um den Auftrag durchzuführen. Nach § 122 Abs. 1 GWB werden öffentliche Aufträge an fachkundige und leistungsfähige (geeignete) Unternehmen vergeben. Die Eignungskriterien dürfen dabei nach § 122 Abs. 2 Satz 2 GWB ausschließlich die Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung, die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit sowie die technische und berufliche Leistungsfähigkeit der Unternehmen betreffen. Die Rechtsprechung des EuGH hat hier Einklang in das Gesetz gefunden: Nach § 122 Abs. 4 Satz 1 GWB müssen die Eignungskriterien mit dem Auftragsgegenstand in Verbindung und zu diesem in einem angemessen Verhältnis stehen. Satz 2 bestimmt, dass die Eignungskriterien bereits in der Auftragsbekanntmachung, der Vorinformation bzw. der Aufforderung zur Interessensbetätigung transparent aufzuführen sind.
Die technische und berufliche Leistungsfähigkeit von Unternehmen steht bei der Eignungsprüfung im Hinblick auf nachhaltige Kriterien an vorderster Stelle.23 Hierzu enthält § 46 VgV24 weitere Einzelheiten und bestimmt, dass öffentliche Auftraggeber Anforderungen aufstellen dürfen, die sicherstellen, dass die Bewerber oder Bieter über die erforderlichen personellen und technischen Mittel sowie ausreichende Erfahrungen verfügen, um den Auftrag in angemessener Qualität ausführen zu können. Nach § 48 Abs. 2 Satz 1 VgV darf der Auftraggeber von den Unternehmen zum Nachweis der Eignung grundsätzlich nur Eigenerklärungen fordern.
Zum Nachweis der technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit sind im Hinblick auf umweltfreundliche Kriterien insbesondere Referenzen (§ 46 Abs. 3 Nr. 1 VgV), Maßnahmen zur Qualitätssicherung (§ 46 Abs. 3 Nr. 3 VgV), Angaben zum Lieferkettenmanagement- und Lieferkettenüberwachungssystem (§ 46 Abs. 3 Nr. 4 VgV) sowie Angaben der Umweltmanagementmaßnahmen, die das Unternehmen während der Auftragsausführung anwendet (§ 46 Abs. 3 Nr. 7 VgV), von Bedeutung. Bei den Umweltmanagementmaßnahmen handelt es sich um ein unternehmensbezogenes Kriterium, das das Unternehmen allgemein, d.h. unabhängig von der ausgeschriebenen Leistung betrifft.25 Die Umweltmanagementmaßnahmen können beispielsweise eine abfallarme oder energieeffiziente Produktionsweise betreffen.26 Die beiden anerkanntesten und wichtigsten Umweltmanagementsysteme sind EMAS27 und die DIN EN ISO 14001.28
Dreh- und Angelpunkt der Eignungsprüfung sind häufig Referenzen vorheriger, vergleichbarer Leistungen. Wann eine Referenz zum Nachweis der Eignung eines Unternehmens geeignet ist, muss der Auftraggeber in der Auftragsbekanntmachung festlegen.29 Beispielsweise können öffentliche Auftraggeber von potenziellen Bietern in der Baubranche fordern, Nachweise für ihre Erfahrung mit umweltfreundlichen Bauprojekten vorzulegen. Diese Nachweise können den Einsatz nachhaltiger Baumaterialien, Energieeffizienzmaßnahmen und die Minimierung von Abfall und Emissionen betreffen.
4.2. Umweltbezogene Zuschlagskriterien
Öffentliche Auftraggeber dürfen – und müssen in manchen Fällen sogar – auch bei der Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots im Wettbewerb nachhaltige, ökologische und umweltbezogene Ziele berücksichtigen. Dabei darf ein Auftraggeber nicht nur die Umweltauswirkungen der Nutzung des Produktes oder der Dienstleistung betrachten, sondern auch der Herstellung, der vorgelagerten Rohstoffgewinnung und der späteren Entsorgung („Lebenszyklus-Ansatz“).30
Umweltbezogene Zuschlagskriterien aufzustellen, mag einem Auftraggeber sogar leichter fallen als umweltbezogene Anforderungen an den Auftragnehmer im Rahmen der Eignungsprüfung. Das Vergaberecht überlässt dem Auftraggeber großzügige Spielräume mit Blick auf die umweltbezogene Angebotswertung. Ausgangspunkt ist dabei immer die zu beschaffende Leistung bzw. der Beschaffungszweck.31
Dass Auftraggeber ein Angebot auf der Grundlage von Umweltschutzkriterien bewerten und auf diese Weise umweltschützende Aspekte in das Vergabeverfahren einführen dürfen, hat der EuGH zunächst in den Rechtssachen Concordia Bus Finland32 und Wienstrom33 anerkannt: Er ordnete auftragsbezogene Umweltkriterien als immanenten und zulässigen Aspekt eines weiten Wirtschaftlichkeitsbegriffs ein, der für „subjektive” Wertungen der zuständigen Beschaffungsstelle offen ist. Diesem Verständnis hat die Vergaberechtsmodernisierung34 Rechnung getragen und den Gedanken teilweise ausdrücklich im Vergaberecht geregelt.35
4.2.1. Wertungsrelevante Umweltaspekte
Um Umweltaspekte im Rahmen der Zuschlagserteilung zu berücksichtigen, können öffentliche Auftraggeber beispielsweise auf folgende Aspekte besonders achten:
- Geringerer Energieverbrauch,
- längere Haltbarkeit,
- Verfügbarkeit von Ersatzteilen,
- einfache und umweltschonende Entsorgung.36
Regelmäßig kommt es auch auf mittelbare Eigenschaften der Produkte an. Beispiele hierfür sind etwa die Produktionsmethoden, die Lebenszykluskosten sowie sonstige externe Kosten.37
4.2.1.1. Praxisbeispiel Nr. 1: Beschaffung von Standard-Software
Bei der Beschaffung von Standard-Software kommen insbesondere folgende umweltbezogene Kriterien für die Bewertung der Angebote in Frage:
- Hardware-Auslastung im Leerlauf der Software;
- Hardware-Inanspruchnahme und Energiebedarf bei Ausführung eines Standardnutzungsszenarios.38
Um diese beiden Kriterien anwenden zu können, muss der Auftraggeber ein Referenzsystem und ein Standardnutzungsszenario festlegen. Als Referenzsystem sollte der Auftraggeber das System vorgeben, auf dem die zu beschaffende Software später laufen soll. Das Standardnutzungsszenario sollte möglichst viele Standardaufgaben enthalten, die in einem typischen Arbeitsablauf bei dem Auftraggeber vorkommen.39
4.2.1.2. Praxisbeispiel Nr. 2: Beschaffung von Servern und Datenspeicherprodukten
Für die Beschaffung von Servern und Datenspeicherprodukten kommen für die Bewertung der Angebote insbesondere folgende umweltbezogene Kriterien in Frage:
Wichtig ist für den Auftraggeber, dass er die Angaben von allen Bietern einheitlich – insbesondere hinsichtlich der technischen Einheiten – abfragt und mit seinen Mindestanforderungen in Gleichklang bringt.
4.2.2. Lebenszykluskosten
Indem der Auftraggeber die Lebenszykluskosten des Beschaffungsgegenstandes als maßgebliches Wertungskriterium in die Zuschlagsentscheidung einbezieht, kann er die finanzielle Wirtschaftlichkeit der zu beschaffenden Produkte besser einschätzen. Die lebenszyklusorientierte Betrachtung (sog. life cycle costing) berücksichtigt alle Kosten, die über die gesamte Lebensdauer eines Beschaffungsgegenstandes entstehen.
Dem öffentlichen Auftraggeber steht es gemäß § 59 Abs. 1 VgV ausdrücklich frei, dass das Zuschlagskriterium „Kosten“ auf der Grundlage der Lebenszykluskosten berechnet wird.
Gemäß § 59 Abs. 2 VgV darf die Berechnung die folgenden Bestandteile umfassen:
- die Anschaffungskosten,
- die Nutzungskosten, insbesondere den Verbrauch von Energie und anderen Ressourcen,
- die Wartungskosten,
- Kosten am Ende der Nutzungsdauer, insbesondere die Abholungs-, Entsorgungs- oder Recyclingkosten, oder
- Kosten, die durch die externen Effekte der Umweltbelastung entstehen, die mit der Leistung während ihres Lebenszyklus in Verbindung stehen (bspw. Emission von Treibhausgasen und anderen Schadstoffen, sonstige Kosten für die Eindämmung des Klimawandels), sofern ihr Geldwert entsprechend den Voraussetzungen aus § 59 Abs. 3 VgV bestimmt und geprüft werden kann.43
Die Voraussetzungen, denen die Berechnungsmethode genügen muss, ergeben sich ausdrücklich aus § 59 Abs. 3 VgV. Bislang hat die EU keine verbindliche Berechnungsmethode im Sinne von § 59 Abs. 4 VgV vorgegeben. Der öffentliche Auftraggeber kann sich aber an Arbeitshilfen oder Normvorgaben orientieren (z.B. Lebenszykluskostenberechnung nach DIN 18960 oder andere, vergleichbare Normen, Werkzeuge, Arbeitshilfen).44
Die Berechnungsmethode sowie die zur Berechnung von den Bietern einzureichenden Informationen sind entweder in der Auftragsbekanntmachung oder in den Vergabeunterlagen anzugeben. Zu empfehlen ist die Angabe in den Vergabeunterlagen, denn im Gegensatz zur Auftragsbekanntmachung ist der Auftraggeber hier in der Zeichenanzahl nicht beschränkt. Er kann die Berechnung der Lebenszykluskosten sowie die Anforderungen an die Angebote dadurch ausführlicher erläutern.45
4.2.3. Berücksichtigung der Energieeffizienz
Bei der Beschaffung von energieverbrauchsrelevanten Waren, technischen Geräten oder Ausrüstungen sind öffentliche Auftraggeber gemäß § 67 Abs. 2 VgV dazu verpflichtet, die Energieeffizienz der Beschaffungsgegenstände angemessen zu berücksichtigen.
Die „Angemessenheit“ eröffnet dem Auftraggeber einen Ermessensspielraum: Die Beurteilung der Angemessenheit ist vom jeweiligen Einzelfall abhängig. Der Gesetzgeber hat mit der Begründung der Verordnung aber klargestellt, dass trotz der besonderen Bedeutung des Energieeffizienzkriteriums weitere funktionale und qualitative Anforderungen an das Produkt nicht in den Hintergrund treten müssen, wenn der Auftraggeber diese für wichtig hält.46
Die Energieeffizienz kann der Auftraggeber zum einen über die Wertung der Lebenszykluskosten (bspw. Energiekosten in der Nutzungsphase und Leistungsaufnahme im Ruhe-Zustand) und zum anderen über die Bewertung konkreter Angaben zum Energieverbrauch berücksichtigen.47
4.2.4. Zuschlagskriterien und Nebenangebote
Um von dem Know-how der Bieter zu profitieren und insbesondere in zügig voranschreitenden Bereichen aktuelle Entwicklungen zu berücksichtigen, dürfen Auftraggeber auch Nebenangebote über umweltfreundliche Alternativen bei den bietenden Unternehmen abfragen (§ 35 VgV). Dabei müssen Auftraggeber gemäß § 35 Abs. 2 Satz 2 VgV beachten, dass sie die Zuschlagskriterien so festlegen, dass diese sowohl auf Hauptangebote als auch auf Nebenangebote anwendbar sind.48
4.2.5. Bundesbehörden: Umweltfreundliche Erzeugnisse sind zu bevorzugen
Bundesbehörden sowie die der Aufsicht des Bundes unterstehenden Personen des öffentlichen Rechts, Sondervermögen und sonstigen Stellen müssen bei der Beschaffung oder Verwendung von Material und Gebrauchsgütern Erzeugnissen den Vorzug geben, die
- in rohstoffschonenden, energiesparenden, wassersparenden, schadstoffarmen oder abfallarmen Produktionsverfahren hergestellt worden sind,
- durch Vorbereitung zur Wiederverwendung oder durch Recycling von Abfällen, insbesondere unter Einsatz von Rezyklaten, oder aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt worden sind,
- sich durch Langlebigkeit, Reparaturfreundlichkeit, Wiederverwendbarkeit und Recyclingfähigkeit auszeichnen oder
- im Vergleich zu anderen Erzeugnissen zu weniger oder schadstoffärmeren Abfällen führen oder sich besser zur umweltverträglichen Abfallbewirtschaftung eignen.49
Diese Verpflichtung gilt, soweit die Erzeugnisse für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet sind, durch ihre Beschaffung oder Verwendung keine unzumutbaren Mehrkosten entstehen, ein ausreichender Wettbewerb gewährleistet wird und keine anderen Rechtsvorschriften entgegenstehen.50 Zweck der Regelung ist es, die Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen zu fördern und den Schutz von Mensch und Umwelt bei der Erzeugung und Bewirtschaftung von Abfällen sicherzustellen. Der Bund und die mit ihm verbundenen öffentlichen Stellen sollen mit Blick darauf eine Vorbildfunktion erfüllen.51
4.2.6. Bundesbehörden: AVV-Klima
Die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Beschaffung klimafreundlicher Leistungen (AVV-Klima) vom 15.9.2021 entwickelt die bis dato geltende AVV-EnEFF weiter, welche die Behörden des Bundes bereits seit 2008 verpflichtete, bei der Vergabe öffentlicher Aufträge besondere Kriterien zur Energieeffizienz der zu beschaffenden Leistungen vorzugeben.
Insbesondere enthält die Verwaltungsvorschrift die Vorgabe, Umweltaspekte bereits im Rahmen der Bedarfsanalyse zu berücksichtigen. Sie verpflichtet Auftraggeber grundsätzlich dazu, auf Basis des CO2-Schattenpreises die Kosten des Treibhausgasausstoßes über den gesamten Lebenszyklus des Beschaffungsgegenstandes bei der Wirtschaftlichkeitsbewertung der Angebote zu berücksichtigen.52 Der CO2-Schattenpreis lässt sich in Orientierung am Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) prognostisch berechnen und monetarisieren.53
5. Grenzen
Wie oben beschrieben, haben Auftraggeber einen sehr weiten Ermessensspielraum, sich umweltbezogenen Eignungs- und Zuschlagskriterien zu bedienen. Dem Spielraum sind vergaberechtlich aber auch Grenzen gesetzt.
Der Auftraggeber ist bei allen Entscheidungen gehalten, die vergaberechtlichen Grundsätze, die sich im Wesentlichen aus § 97 GWB ergeben, sowie die EU-primärrechtlichen Grundsätze einzuhalten. Die wichtigsten Grenzen sind im Überblick:54
- Auftragsbezogenheit und Angemessenheit,
- Transparenz und Objektivität,
- Gleichbehandlungsgebot und Diskriminierungsverbot.
5.1. Auftragsbezogenheit und Angemessenheit
Der Auftraggeber darf als umweltbezogene Zuschlagskriterien all diejenigen Merkmale berücksichtigen, die auch als Teil der Leistungsbeschreibung zulässig sind und mit dem Auftragsgegenstand im Zusammenhang stehen.55
Die Verbindung ist laut dem Gesetz auch dann anzunehmen, wenn sich ein Zuschlagskriterium auf Prozesse im Zusammenhang mit der Herstellung, Bereitstellung oder Entsorgung der Leistung, auf den Handel mit der Leistung oder auf ein anderes Stadium im Lebenszyklus der Leistung bezieht, auch wenn sich diese Faktoren nicht auf die materiellen Eigenschaften des Auftragsgegenstandes auswirken.56
Die Zuschlagskriterien müssen außerdem in einem angemessenen Verhältnis zu dem Beschaffungszweck stehen.57
Auch die Eignungskriterien müssen mit dem Auftragsgegenstand in Verbindung und zu diesem in einem angemessenen Verhältnis stehen.58 Dies ist der Fall, wenn das Eignungskriterium objektiv dazu dient und geeignet ist, die Leistungsfähigkeit des Bieters im Hinblick auf den konkret ausgeschriebenen Auftragsgegenstand nachzuweisen.59
5.2. Transparenz und Objektivität
Um willkürliche Entscheidungen des Auftraggebers zu verhindern, stellt das Vergaberecht besonders hohe Anforderungen an die Transparenz von Eignungs- und Zuschlagskriterien.
Die Eignungskriterien sind zwingend in der Auftragsbekanntmachung anzugeben.60 Der Auftraggeber darf hiervon im weiteren Verlauf nicht abweichen, er darf sie auch nicht ändern. Potentielle Bieter sollen sich möglichst frühzeitig informieren können, ob sie für den Auftrag in Betracht kommen und abhängig davon entscheiden, ob sie sich an dem Verfahren beteiligen wollen.61
Die Zuschlagskriterien müssen gemäß § 127 Abs. 5 GWB in der Auftragsbekanntmachung oder den Vergabeunterlagen angegeben werden. Dabei muss der Auftraggeber den Bietern sämtliche Zuschlagskriterien, Unterkriterien, Gewichtungsregeln oder Bewertungsmatrizen vollständig offenlegen.62 Die Zuschlagskriterien müssen hinreichend klar und deutlich formuliert sein – fachkundige Bieter dürfen keine Verständnisschwierigkeiten haben.
Die Bieter müssen auf den Bestand der Zuschlagskriterien vertrauen können, damit sie ihr Angebot an diesen Kriterien ausrichten können.63
In der Folge darf der Auftraggeber bei der Wertung der Angebote auch nur die bekanntgemachten Kriterien und Maßstäbe verwenden. Nach dem Ablauf der Angebotsfrist dürfen die Zuschlagskriterien grundsätzlich nicht mehr geändert werden. Eine Korrektur der Zuschlagskriterien ist nur zulässig, wenn die bekannt gemachten Zuschlagskriterien rechtswidrig, ungeeignet oder missverständlich sind. Dann muss der Auftraggeber aber das Verfahren mindestens in den Stand vor der Aufforderung zur Angebotsabgabe zurückversetzen und die Bieter zur Abgabe neuer Angebote auffordern.64
5.3. Gleichbehandlungsgebot und Diskriminierungsverbot
Der Grundsatz der Gleichbehandlung der Bieter soll dafür sorgen, dass der Auftraggeber den Zuschlag nicht willkürlich erteilt und das Vergabeverfahren fair gestaltet.65
Die Bieter haben einen Anspruch darauf, dass der Auftraggeber seine Auswahl der geeigneten Bieter sowie des wirtschaftlichsten Angebots nach pflichtgemäßem Ermessen trifft und dabei alles unterlässt, was eine Benachteiligung einzelner Unternehmen nach sich ziehen würde.66
Das Gleichbehandlungsgebot und Diskriminierungsverbot erfasst dabei sowohl offene als auch versteckte Diskriminierungen. Versteckte Diskriminierungen liegen beispielsweise vor, wenn der Auftraggeber im Vergabeverfahren Kriterien heranzieht, die formal nicht diskriminierend wirken, tatsächlich aber dazu führen, dass bestimmte Bieter besser abschneiden als andere.67
Ein Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz liegt beispielsweise vor, wenn der Auftraggeber
- vorschreibt, dass Bieter ausschließlich oder überwiegend inländische Produkte68 oder inländisches Material69 zu verwenden haben,
- fordert, dass ein Teil der Arbeiten durch regionale Subunternehmer auszuführen ist,70
- manche Bieter früher als andere über kalkulationsrelevante Aspekte informiert,71
- Zuschlagskriterien verwendet, die nicht oder nicht hinreichend bekannt gemacht wurden.72
Allerdings ist eine Benachteiligung einzelner Bieter dann zulässig, wenn dies aufgrund eines Gesetzes ausdrücklich geboten oder gestattet ist. Eine Ungleichbehandlung kann im Einzelfall durch die Berücksichtigung von strategischen Aspekten wie etwa dem Umweltschutz geboten sein, wenn sie durch einen sachlichen Grund gerechtfertigt und zugleich verhältnismäßig ist.73 Dies gilt beispielsweise, wenn die Lebenszykluskosten durch kürzere Transportwege für inländische Unternehmen insgesamt geringer ausfallen.
6. Fazit und Ausblick
Das Vergaberecht eröffnet öffentlichen Auftraggebern zahlreiche Möglichkeiten, den Umweltschutz zu priorisieren. Die Auswahl geeigneter Unternehmen sowie die Wahl umweltbezogener Zuschlagskriterien stellen mächtige Instrumente dar, um dieses Ziel zu erreichen. Während im Rahmen der Eignungskriterien der Umweltschutz eher übergeordnet eine Rolle spielt, d.h. bezogen auf das Verhalten des Unternehmens im Allgemeinen, kann der Auftraggeber bei den Zuschlagskriterien sehr konkret auf die Umstände des jeweiligen Leistungsgegenstandes eingehen.
Neben den hier fokussiert betrachteten Eignungs- und Zuschlagskriterien ergeben sich für den Auftraggeber aber noch weitere Stellschrauben: Die Untersuchung möglicher Auswirkungen im Rahmen der Markterkundung, das Festlegen von umweltbezogenen Mindestanforderungen in der Leistungsbeschreibung sowie die Bestimmung umweltbezogener Ausführungsbedingungen.74 Ob öffentliche Auftraggeber in Zukunft mehr Gebrauch von diesen Möglichkeiten machen und wie die Rechtsprechung darauf reagiert, bleibt noch abzuwarten.