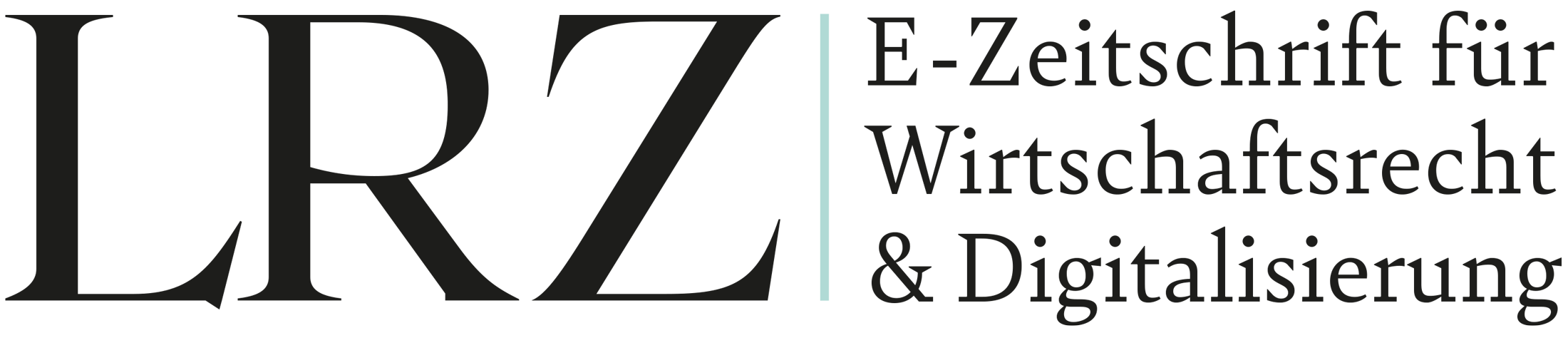Sprache auswählen

Die Bedeutung von Nachhaltigkeitsaspekten bei der Leitung und Kontrolle börsennotierter Aktiengesellschaften de lege lata und de lege ferenda

- Prof. Dr. Stefan Brass
- Professor für Bürgerliches Recht und Gesellschaftsrecht, Frankfurt University of Applied Sciences

- Prof. Dr. Jürgen Telke
- Professor, Wiesbaden Business School / Hochschule RheinMain
Zitiervorschlag: Brass/Telke, LRZ 2023, Rn. 119, [●], www.lrz.legal/2023Rn119.
Permanente Kurz-URL: LRZ.legal/2023Rn119
Seit der Finanzkrise 2008/2009 bezwecken zahlreiche Regulierungsinitiativen ein Umdenken in der tradierten Unternehmenskultur: Unternehmen von öffentlichem Interesse sollen auf sowohl unmittelbarem als auch mittelbarem Wege veranlasst werden, ihre Wertschöpfung nachhaltiger auszurichten. Der Beitrag untersucht, mit welchen regulatorischen Mitteln dieses Ziel erreicht werden soll und inwieweit das geltende Recht sowie der Deutsche Corporate Governance Kodex (DCGK) nachhaltiges unternehmerisches Handeln vorschreiben oder aufdecken. Dieses Gesamtbild wird schließlich bewertet und dargelegt, ob darüber hinaus sonstige Maßnahmen für eine weitere Entwicklung einer nachhaltigen Unternehmenskultur angezeigt erscheinen.
- 1. Einführung
- 2. Regulierungsinitiativen
- 3. Nachhaltige Unternehmensführung und -kontrolle nach dem geltenden Recht und dem Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK)
- 3.1. Aktienrecht
- 3.2. Nichtfinanzielle Berichterstattung nach dem CSR-RUG / HGB
- 3.3. Nachhaltige Unternehmensführung und -kontrolle nach dem DCGK
- 3.3.1. Nachhaltige Orientierungsleitlinien / Stakeholder-Value Konzept
- 3.3.2. Integration von Nachhaltigkeitsaspekten in Unternehmensstrategie, -planung und internem Kontroll- und Risikomanagementsystem
- 3.3.3. Kontrolle nachhaltiger Unternehmensführung
- 3.3.4. Vergütungsanreize für eine nachhaltige Unternehmenspolitik
- 4. Kritische Würdigung und Regulierungsausblick
1. Einführung
Seit der Finanzkrise 2008/2009 bezwecken zahlreiche Regulierungsinitiativen ein Umdenken in der tradierten Unternehmenskultur: Unternehmen von öffentlichem Interesse sollen auf sowohl unmittelbarem als auch mittelbarem Wege veranlasst werden, ihre Wertschöpfung nachhaltiger auszurichten.1 Diese Transformation zu einem nachhaltigeren Finanz- und Wirtschaftssystem soll dabei den geänderten gesellschaftlichen Erwartungen, insb. im Hinblick auf eine Bekämpfung des Klimawandels, Rechnung tragen.2
Jüngst haben der europäische Richtliniengeber mit seinem Entwurf zur Corporate Sustainability Reporting Directive (CSR-RL)3 und der nationale Gesetzgeber mit dem CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz (CSR-RUG) sowie dem Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten (Lieferkettengesetz) mehrere Regulierungen bzw. Regulierungsvorschläge ins Feld geführt, die einen entsprechenden Wandel in der Unternehmenskultur bewirken sollen. Darüber hinaus diskutiert die EU-Kommission derzeit eine weitere Regulierung der nachhaltigen Unternehmensführung und -kontrolle (Sustainable Corporate Governance), da sich ihrer Auffassung nach zahlreiche Unternehmen noch immer zu stark auf ihren kurzfristigen finanziellen Ertrag anstatt auf ihre langfristige Entwicklung und auf Nachhaltigkeitsaspekte konzentrieren.4 Auch die Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex5 hat 2022 den Deutschen Corporate Governance Kodex an die geänderten Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Unternehmensführung und -kontrolle angepasst.
Um zu beurteilen, ob die aktuellen regulatorischen Maßnahmen für eine derart weitreichende Kulturtransformation geeignet und ausreichend erscheinen, soll im Folgenden zunächst aufgezeigt werden, was als sog. „nachhaltiges“ Verhalten von Unternehmen erwünscht wird und mit welchen Regulierungsinitiativen derartige unternehmerische Maßnahmen hervorgerufen werden sollen (unter II.). Anschließend wird ermittelt, inwieweit damit bereits das geltende Recht sowie der Deutsche Corporate Governance Kodex (DCGK) nachhaltiges unternehmerisches Handeln vorschreiben oder aufdecken (unter III.). Dieses Gesamtbild wird schließlich bewertet und dargelegt, ob darüber hinaus sonstige Maßnahmen für eine weitere Entwicklung einer nachhaltigen Unternehmenskultur angezeigt erscheinen (unter IV.).
Im Fokus der Untersuchung stehen ausschließlich börsennotierte Aktiengesellschaften: Aufgrund ihrer üblichen Unternehmensgröße und ihrer typischerweise verstärkten öffentlichen Einbindung kommt diesen als großen Unternehmensträgern von öffentlichem Interesse eine Vorreiterrolle zu. Als Adressaten mehrerer regulatorischer Bemühungen können und sollen sie daher vorrangig klima- und sozialpolitisch erwünschte Verhaltensänderungen in der Unternehmenswelt umsetzen. So ist davon auszugehen, dass es börsennotierten Aktiengesellschaften aufgrund ihrer Ausstattung sowie der Professionalisierung der internen Corporate Governance leichter fallen dürfte, sich an Nachhaltigkeitsvorgaben anzupassen, als z.B. KMUs.6 Alternativ ließe sich indes bei mehreren Regulierungsvorhaben anstelle der Börsennotierung auch auf die Größe (z.B. die Mitarbeiterzahl) abstellen.7 Sollte eine Anpassung erfolgreich verlaufen, könnten entsprechende Vorgaben und erprobte Anpassungsmodelle später auch auf sonstige Unternehmen oder Unternehmensträger ausgeweitet werden.
2. Regulierungsinitiativen
Insbesondere folgende Regulierungsinitiativen bezwecken dabei die Entwicklung und Förderung nachhaltigen unternehmerischen Handelns:
2.1. Corporate Sustainability Reporting Directive (2014)
Die CSR-Richtlinie sieht für bestimmte große Unternehmen und Gruppen nichtfinanzielle Berichtspflichten vor (vgl. §§ 289b, 289c HGB). Mit dem EU-Änderungsentwurf wird zudem angestrebt, die Organe der Aktiengesellschaft stärker in die Überwachung nachhaltigen Handelns einzubinden. So soll der Aufsichtsrat die finanzielle Berichterstattung künftig mit der gleichen Intensität prüfen wie die finanzielle Berichterstattung im Jahresabschluss.8
Interessant ist auch, welche Elemente die CSR-Richtline unter den Nachhaltigkeitsbegriff subsumiert, da bislang weder auf internationaler noch auf nationaler Ebene eine entsprechende Legaldefinition besteht. Unter Nachhaltigkeit werden nach Pkt. 3 Erwägungsgründe i.V.m. Art. 1 CSR-RL insbesondere Umweltbelange und soziale Belange verstanden. Unter die sozialen Belange fallen insbesondere Arbeitnehmerbelange, Menschenrechte und Korruptionsbekämpfung.
Es fällt auf, dass wirtschaftliche Faktoren, z.B. die dauerhafte finanzielle Absicherung des Unternehmens oder eine sachgerechte Corporate Governance (langfristig stabile Strukturierung des Unternehmens mittels Satzung, Geschäftsordnungen etc.) nicht unter den Nachhaltigkeitsbegriff nach dem Verständnis der EU-Kommission zu fallen scheinen. Zudem soll eine Sanktionierung nicht-nachhaltigen Handelns allein durch den Markt erfolgen, von welchem erwartet wird, dass er auf die Berichterstattung der Aktiengesellschaft adäquat reagieren wird.
2.2. Deutscher Nachhaltigkeitskodex (2017)
Auch der im Juli 2017 an die Vorgaben der CSR-RL bzw. das CSR-RUG und im Frühjahr 2020 u.a. an die Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen9 angepasste Deutsche Nachhaltigkeitskodex i.d.F. 2020 sieht – analog zur CSR-RL – im Wesentlichen Berichtspflichten nur zu den Bereichen Umwelt und Soziales vor. Ökonomische Themen spielen hingegen nur eine untergeordnete Rolle.10
2.3. EU-Änderungsrichtlinie zur Aktionärsrechterichtlinie (2017)
Mit der Änderungsrichtlinie zur EU-Aktionärsrechterichtlinie11 wurde dann erstmals eine Regelung getroffen, wonach die Vernachlässigung nachhaltigen Handelns zu konkreten materiellen Nachteilen für den Vorstand führen kann. Die Einhaltung der in der „Vergütungspolitik“ aufgestellten Nachhaltigkeitsvorgaben soll die Höhe der Vorstandsvergütung bestimmen und der Überwachung durch die Aktionäre unterliegen (Art. 1 Nr. 4 Änd-RL, betreffend Art. 9a Abs. 2 und 6 AR-RL).
Zudem erhält der Nachhaltigkeitsbegriff eine ökonomische Erweiterung, wonach Aktiengesellschaften weg von einer „übermäßigen kurzfristigen Risikobereitschaft“, die „zu stark auf kurzfristige Gewinne ausgerichtet ist“, hin zu einer stabilen „Corporate-Governance und Wertentwicklung“ zu führen sind (Erwägungsgrund 2 der Änd-RL). Was unter der gewünschten Werteentwicklung zu verstehen ist, konkretisieren Pkt. 14, 29 Erwägungsgründe Änd-RL, im Wesentlichen Ökologie und Soziales. Unter dem Begriff der Nachhaltigkeit wird also eine Verflechtung von Ökologie, sozialen Aspekten und Corporate Governance (insb. im Sinne einer Überwachung der langfristig ausgerichteten Unternehmensentwicklung durch die Hauptversammlung) verstanden.
Interessant ist, dass der europäische Gesetzgeber davon ausgeht, dass eine langfristig stabile Lage der Aktiengesellschaft nur möglich ist, wenn diese auch ökologische und soziale Themen in ihr Geschäftsmodell einbezieht. Des Weiteren wird davon ausgegangen, dass die bisher übliche Corporate Governance (weitgehende Unabhängigkeit von Vorstand und Aufsichtsrat von den Aktionären) nicht mehr ausreichend ist, um dies zu gewährleisten.
2.4. ARUG II (2019)
In deutsches Recht wurde die AR-RL durch das ARUG II inkorporiert. Gemäß neugefasstem § 87 Abs. 1 S. 2 AktG ist die Vergütungsstruktur bei börsennotierten Gesellschaften „auf eine nachhaltige und langfristige Entwicklung der Gesellschaft auszurichten“. Eine gesetzgeberische Konkretisierung des Begriffes der „Nachhaltigkeit“ enthalten weder das AktG noch die begleitenden Gesetzesmaterialien.12
Einige Stimmen in der Literatur legen den Begriff der „Nachhaltigkeit“ restriktiv im Sinne einer langfristigen Rentabilität und Unternehmensstabilität aus und klammern sonstige Nachhaltigkeitsaspekte eher aus.13 Dem steht jedoch die Stellungnahme des Rechtsausschusses des Bundestages entgegen: „Die bisherige Verpflichtung des Aufsichtsrates, bei der Festsetzung der Vorstandsvergütung auf eine „nachhaltige“ Entwicklung der Gesellschaft zu achten, ist von der Praxis und Literatur ganz überwiegend im Sinne einer „langfristigen Entwicklung“ verstanden worden. Mit der Dopplung der Begriffe „nachhaltig“ und „langfristig“ möchte der Ausschuss deutlich machen, dass der Aufsichtsrat bei der Festsetzung der Vergütung, insbesondere der Wahl der Vergütungsanreize auch soziale und ökologische Gesichtspunkte in den Blick zu nehmen hat.“14 So sah der Gesetzesentwurf zwischenzeitlich nur der Begriff der Langfristigkeit“ vor und wurde auf Betreiben des Rechtsausschusses um den Begriff der „Nachhaltigkeit“ ergänzt.15
Fraglich ist, ob der Begriff der „Nachhaltigkeit“ nur soziale und umweltbezogene Belange umfasst oder ebenso eine ökonomische Komponente vorsieht. Auch wenn der Rechtsausschuss den Ökonomiefaktor in seiner Stellungnahme nicht eindeutig benennt, ist nicht ersichtlich, dass dies aus dem Begriff der „Nachhaltigkeit“ ausgeklammert sein soll. Zumindest lassen sich ökonomische Komponenten wohl unter den Begriff der „Langfristigkeit“ in § 87 Abs. 1 S. 2 AktG fassen, denn eine langfristig stabile Unternehmensentwicklung setzt immer eine entsprechend stabile ökonomische Entwicklung voraus.
Der These, dass sich ökonomische Faktoren zumindest unter den Begriff der „Langfristigkeit“ subsumieren lassen, entspricht auch die klare Intention der Änd-RL zur AR-RL. Danach sind Aktiengesellschaften weg von einer „übermäßigen kurzfristigen Risikobereitschaft“, die „zu stark auf kurzfristige Gewinne ausgerichtet ist“, hin zu einer stabilen „Wertentwicklung“ zu führen, Pkt. 2 Erwägungsgründe Änd-RL.
Aufgrund der Verbindung der „Nachhaltigkeit“ und ökonomischer Faktoren, sowohl auf EU-Ebene in der Änd-RL als auch auf nationaler Ebene in § 87 Abs. 1 S. 2 AktG fallen diese wohl auch unter den Begriff der Nachhaltigkeit. Entsprechend umfasst der Nachhaltigkeitsbegriff im Sinne des ARUG II Ökologie, Soziales und Ökonomie (insb. im Sinne einer langfristig ausgerichteten Unternehmensentwicklung).
2.5. EU-Taxonomie-Verordnung (2020)
Mit ihrer Taxonomie-VO16 hat die EU den ökologischen Aspekt des Nachhaltigkeitsbegriffs näher definiert (Art. 1 Abs. 1 iVm. Art. 3 Taxonomie-VO). Ansonsten ergeben sich aus der Verordnung keine weitergehenden Nachhaltigkeitspflichten für Aktiengesellschaften, als dass die schon bestehenden Berichtspflichten in ökologischer Hinsicht klarer umrissen werden.17
2.6. Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (2021)
Mit dem LkSG wurden die Rechtsfolgen für Verstöße gegen Nachhaltigkeitspflichten erheblich ausgeweitet. Bisherige Verstöße hatten nur zu indirekten finanziellen Einbußen geführt, z.B. geringere Marktakzeptanz als Folge der nichtfinanziellen Berichterstattung oder geringere Vorstandsvergütung bei Verfehlung von Nachhaltigkeitsindikatoren. Demnach sollte sich die Privatwirtschaft bislang möglichst selbst regulieren. Das LkSG gibt dem Staat erstmals weitreichende Kontroll- und Eingriffsmöglichkeiten, z.B. in Form von behördlichen Handlungsanordnungen, Bußgeldern, dem Ausschluss von öffentlichen Aufträgen, etc.
Hierbei wird der Nachhaltigkeitsbegriff nicht explizit verwendet und es wird nur auf die Nachhaltigkeitsbereiche „Soziales“ (insb. bzgl. Menschenrechte) und im geringeren Maße „Umwelt“ eingegangen.18 Ein Erfordernis langfristig ausgerichteten unternehmerischen Handelns ist zum Beispiel nicht enthalten. Auch hier zeigt sich wieder, dass es einer klaren Regelung bedarf, was unter den Nachhaltigkeitsbegriff zu fassen ist und in welchem Verhältnis die einzelnen Nachhaltigkeitsbereiche zueinander stehen.
3. Nachhaltige Unternehmensführung und -kontrolle nach dem geltenden Recht und dem Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK)
3.1. Aktienrecht
Im Folgenden soll untersucht werden, inwieweit der Vorstand verpflichtet ist, die Leitung der Aktiengesellschaft an Nachhaltigkeitsbelangen auszurichten. Ferner soll analysiert werden, wie die Haftung des Vorstands bei Nichtbeachtung der Nachhaltigkeitsaspekte ausgestaltet wird und wie ebenfalls die Vorstandsvergütung an Nachhaltigkeitsgesichtspunkten zu bemessen ist.
3.1.1. Leitung der Aktiengesellschaft
Grundsätzlich ist es alleinige Kompetenz des Vorstands die Aktiengesellschaft zu führen (§ 76 Abs. 1 AktG). Hierbei ist er nur an den in der Satzung festgelegten Unternehmensgegenstand und den Gesellschaftszweck gebunden und hat im Übrigen ein weites Leitungsermessen.19
Grundsätzlich sieht das AktG keine spezifischen Nachhaltigkeitspflichten hinsichtlich der Unternehmensleitung vor. Etwas anderes kann sich allenfalls durch ausdrückliche Regelung in Satzung/Geschäftsordnung ergeben.20 Etwas anderes gilt nur, soweit spezialgesetzliche Vorgaben, z.B. aus Umweltgesetzen oder Arbeitnehmerschutzgesetzen, bestehen; darüber hinaus gibt es keine allgemeinen Nachhaltigkeitspflichten.21
Eine bedeutende spezialgesetzliche Regelung von bestimmten Nachhaltigkeitspflichten ist erst unlängst mit dem oben beschriebenen LkSG (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz) erfolgt. Hiernach sind Aktiengesellschaften mit einer bestimmten Arbeitnehmerzahl verpflichtet, innerhalb ihrer Lieferketten bestimmte menschenrechtliche und umweltbezogene Sorgfaltspflichten zu beseitigen (ca. 700 Unternehmen, ca. 2900 ab 2024).22 Da es nur wenige börsennotierte Aktiengesellschaften geben dürfte, die für ihre Wertschöpfung keine Lieferkette benutzen, könnte das LkSG als erster Ansatz einer allgemeinen Nachhaltigkeitspflicht für zumindest große (börsennotierte) Aktiengesellschaften angesehen werden.23
Auf Grundlage der oben zugrunde gelegten Definition von Nachhaltigkeit bedeutet dies, dass – sofern keine spezifischen spezialgesetzlichen Regelungen (insb. LkSG) oder Vorgaben durch Satzung/Geschäftsordnung bestehen – der Vorstand ökologische und soziale Ziele grundsätzlich nicht verfolgen muss und grundsätzlich auch seine ökonomische Planung nicht zwingend langfristig ausrichten muss. Eine Pflicht zur langfristigen Planung wird allenfalls hinsichtlich der dauerhaften Bestandserhaltung der Aktiengesellschaft gesehen.24
3.1.2. Haftung des Vorstands
Sein Leitungsermessen darf der Vorstand nur bis zu der Grenze ausüben, wie es „die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters“ gebietet, § 93 Abs. 1 S. 1 AktG. Andernfalls haftet er der Aktiengesellschaft für den ihr entstandenen Schaden, § 93 Abs. 2 S. 1 AktG.
Da – wie oben ausgeführt – der Vorstand bei der Leitung der Aktiengesellschaft grundsätzlich keiner Nachhaltigkeitspflicht (außer spezialgesetzlich, z.B. durch das LkSG) unterliegt, trifft ihn grundsätzlich auch keine Haftung, wenn er nicht nachhaltig handelt.25 Etwas anderes ergibt sich ausnahmsweise, wenn die Vernachlässigung ökologischer, sozialer oder ökonomischer Aspekte zu einem wirtschaftlichen Schaden der Aktiengesellschaft führt, der bei Anwendung der gebotenen Sorgfalt vermeidbar gewesen wäre.26 Dies wäre z.B. der Fall, wenn die AG aufgrund eines Verstoßes gegen das LkSG ein Bußgeld auferlegt bekommt. Grundsätzlich ist aber festzustellen, dass der Vorstand nicht haftet, wenn er Nachhaltigkeitsaspekte außer Acht lässt.
Fraglich ist, ob er umgekehrt haftet, wenn er sich von Nachhaltigkeitsgesichtspunkten leiten lässt, obwohl es finanziell rentabler wäre, diese außer Acht zu lassen. Wie oben ausgeführt, steht dem Vorstand ein Leitungsermessen zu, ob er gegebenenfalls kurzfristige Schäden zugunsten langfristiger Gewinnmöglichkeiten in Kauf nimmt.27 Selbst wenn sich diese Einschätzung im Nachhinein als falsch erweist und sich die langfristigen Gewinnmöglichkeiten nicht realisieren lassen, trifft ihn gemäß der Business Judgement Rule keine Haftung, § 93 Abs. 1 S. 2 AktG. Der Vorstand haftet also nur dann für Nachhaltigkeitskosten (Umwelt, Soziales, Ökonomie), wenn diese auch unter langfristigen Gesichtspunkten (Reputationsmanagement etc.) schlechthin nicht mit dem Unternehmensgegenstand und -zweck vereinbar sind.28
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass nach derzeitiger Rechtslage – allein aus Haftungsgesichtspunkten – keine besondere Abschreckung, aber auch kein besonderer Anreiz für den Vorstand besteht, die Aktiengesellschaft nachhaltig zu leiten.
3.1.3. Vergütung des Vorstands
Eine börsennotierte Aktiengesellschaft soll für ihren Vorstand ein an der „nachhaltigen und langfristigen Entwicklung der Gesellschaft“ ausgerichtetes Vergütungssystem vorsehen (§ 87 Abs. 1 S. 2 AktG). Wie oben ausgeführt,29 ist hierunter ein Vergütungssystem zu verstehen, welches die Vorstandsvergütung – zumindest auch – anhand von Nachhaltigkeitskriterien (Umwelt- und Sozialziele, nebst langfristig ausgerichteter wirtschaftlicher Stabilität) bemisst.
Gesetzlich oder durch Rechtsprechung ist aber noch nicht geregelt, in welchem Ausmaß Nachhaltigkeitskriterien in die Vergütung einfließen sollen. Diesbezüglich besteht – zumindest zum derzeitigen Rechtsstand – ein weitgehendes Ermessen des Aufsichtsrates.
3.2. Nichtfinanzielle Berichterstattung nach dem CSR-RUG / HGB
Mit Inkrafttreten des CSR-RUG, welches die CSR-RL in deutsches Recht inkorporiert, wurden bestimmte große Unternehmen und Gruppen u.a. dazu verpflichtet, in ihre Lage- bzw. Konzernlageberichte eine nichtfinanzielle (Konzern-)Erklärung aufzunehmen. Auf diese Weise schafft der deutsche Gesetzgeber eine verpflichtende Berichterstattung zu Nachhaltigkeitsbelangen, die einerseits die Transparenz hinsichtlich nachhaltigkeitsbezogenen Handelns der Unternehmen erhöhen soll.30 Zum anderen sollen diese Berichtspflichten mittelbar das Handeln der Unternehmen selbst beeinflussen und einen Anreiz zur verstärkten Berücksichtigung nachhaltigkeitsbezogener Fragestellungen in der Unternehmensführung bieten.31
3.2.1. Berichtspflichtige Unternehmen
Der Anwendungsbereich der nichtfinanziellen Erklärung ist gem. Art. 19a Abs. 1 CSR-RL auf bestimmte große Unternehmen von öffentlichem Interesse beschränkt. § 289b Abs. 1 HGB setzt diese Vorgabe dahingehend um, dass der Berichtspflicht zunächst große Kapitalgesellschaften i.S.d. § 267 Abs. 3 Satz 1 HGB und diesen gleichgestellte Personengesellschaften unterliegen, die überdies kapitalmarktorientiert i.S.d. § 264b HGB sind und im Jahresdurchschnitt mehr als 500 Mitarbeiter beschäftigen.
3.2.2. Inhalt der nichtfinanziellen Berichterstattung
- 289c HGB kodifiziert bestimmte Mindestinhalte für die nichtfinanzielle Erklärung, um dadurch die Vergleichbarkeit der nichtfinanziellen Angaben unterschiedlicher Unternehmen zu erhöhen. Der Gesetzgeber legt aber lediglich ein Mindestspektrum an Berichtspflichten fest, um den Unternehmen eine Berichterstattung im Lichte ihrer individuellen Unternehmensgegebenheiten zu ermöglichen.
Die Festlegung der Inhalte der nichtfinanziellen Berichterstattung folgen einem zweistufigen Vorgehen. So spannt zunächst § 289c Abs. 2 HGB den inhaltlichen Rahmen für die nichtfinanzielle Berichterstattung, indem diese zumindest Bezug auf Umweltbelange, Arbeitnehmerbelange, Sozialbelange, die Achtung der Menschenrechte sowie die Bekämpfung von Korruption und Bestechung zu nehmen haben.
- 289c Abs. 3 HGB legt darauf aufbauend in einem zweiten Schritt die konkreten Berichtspflichten fest. Dies beinhaltet u.a. die wesentlichen Risiken, die mit der eigenen Geschäftstätigkeit verknüpft sind und die sehr wahrscheinlich schwerwiegende negative Auswirkungen auf die nichtfinanziellen Aspekte haben oder haben werden, sowie die Handhabung dieser Risiken; die wesentlichen Risiken, die mit den Geschäftsbeziehungen des Unternehmens, seinen Produkten und Dienstleistungen verknüpft sind und die sehr wahrscheinlich schwerwiegende negative Auswirkungen auf die nichtfinanziellen Aspekte haben oder haben werden (soweit von Bedeutung und verhältnismäßig) sowie die Handhabung dieser Risiken durch das Unternehmen; die bedeutsamsten nichtfinanziellen Leistungsindikatoren, die für die Geschäftstätigkeit des Unternehmens von Bedeutung sind.
Die dargestellten Berichtspflichten sind dabei einer erweiterten Wesentlichkeitsbeurteilung unterworfen. In der Folge sind die gem. § 289c Abs. 3 HGB geforderten Angaben nur zu machen, sofern sie sowohl für das Verständnis von Geschäftsverlauf, Geschäftsergebnis und Lage des Unternehmens („outside-in“-Logik) als auch für das Verständnis der Auswirkungen der Unternehmenstätigkeit auf die nichtfinanziellen Aspekte („inside-out“-Logik) erforderlich sind.
3.2.3. Überprüfung der Berichterstattung
Im Gegensatz zu Jahresabschluss oder Lagebericht wird der Gesetzgeber künftig (CSR-Richtlinie 2.0) eine sowohl formelle wie auch eine inhaltliche Prüfung der nichtfinanziellen Berichterstattung durch den Abschlussprüfer verlangen.32
Allerdings wurde mit dem CSR-RUG auch der Aufsichtsrat zur Prüfung der nichtfinanziellen Berichterstattung verpflichtet, § 171 Abs. 1 AktG. Die Intensität dieser inhaltlichen Prüfung entspricht dabei der, die auch für Abschluss und Lagebericht unterstellt wird.33
3.3. Nachhaltige Unternehmensführung und -kontrolle nach dem DCGK
Aus den obigen Ausführungen zum Aktien- und Handelsrecht ergibt sich, dass die Entwicklung und Verfolgung einer nachhaltigen Unternehmensstrategie weder zwingend vorgeschrieben ist noch eine nicht nachhaltig ausgerichtete Geschäftspolitik zu einer zwingenden Haftung führt. Im Folgenden soll daher aufgedeckt werden, inwieweit sich aus dem Deutschen Corporate Governance_Kodex (DCGK) entsprechende Handlungsvorgaben oder zumindest -anreize ergeben.
Vorstand und Aufsichtsrat der börsennotierten Gesellschaft haben nach § 161 Abs. 1 AktG jährlich einerseits zu erklären, ob den Empfehlungen des Kodex entsprochen wurde (und zukünftig wird). Zugleich ist anzugeben, welche Empfehlungen nicht angewendet wurden und warum nicht (comply or explain).34 Auf diese Weise sollen die aktuellen Aktionäre sowie allgemein auch der Kapitalmarkt über die Einhaltung der als wesentlich eingestuften Empfehlungen und damit über die Corporate Governance der jeweiligen Gesellschaft informiert werden.35 Diese Sichtbarkeit für den Markt mittels des comply or explain-Regelungsmechanismus vermag zudem einen mittelbaren Anreiz oder gar psychologischen Druck dafür zu schaffen, dass die adressierten Akteure tatsächlich insoweit eine nachhaltige Unternehmensführung und -kontrolle in der Gesellschaft umsetzen.36
3.3.1. Nachhaltige Orientierungsleitlinien / Stakeholder-Value Konzept
Das mit dem Stakeholder-Ansatz37 verfolgte betriebswirtschaftliche Nachhaltigkeitskonzept geht davon aus, dass langfristig erfolgreiche Wertschöpfungsprozesse eine Vielzahl von Akteuren erfordern. Unter dem Eindruck der Finanz- und Wirtschaftskrise ab 2007 wurde das Stakeholder-Konzept 2009 erstmals ausdrücklich in die Umschreibung des von Vorstand und Aufsichtsrat als Leitlinie zu beachtenden Unternehmensinteresses aufgenommen.38 Dabei führte der im Jahre 2020 vollständig neugefasste und strukturierte Kodex in seiner Präambel aus, dass die Gesellschaft und ihre Organe sich zugleich in ihrem Handeln der Rolle des Unternehmens in der Gesellschaft und ihrer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst zu sein haben, sowie des Einflusses von Sozial- und Umweltfaktoren auf den Unternehmenserfolg. Dies impliziert, dass sich der Unternehmenserfolg insbesondere durch die Wahrnehmung gesellschaftlicher Verantwortung steigern lässt, und verdeutlicht damit die sog. outside-in-Perspektive nachhaltigen Unternehmenshandelns.
Da zwischenzeitlich die Erwartungen an die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsfaktoren bei der Unternehmensführung wesentlich konkreter geworden seien, wird mit der Kodexreform 2022 auch vor dem Hintergrund der geänderten EU-Richtlinie zur nichtfinanziellen Berichterstattung (CSRD) die Präambel nun um die sog. inside-out-Perspektive nachhaltigen Unternehmenshandeln ergänzt: Hervorgehoben wird dort, dass die Tätigkeiten des Unternehmens Auswirkungen auf Mensch und Umwelt haben, sowie dass Vorstand und Aufsichtsrat dies bei der Führung und Überwachung des Unternehmens zu berücksichtigen haben.39
Die in der Präambel des DCGK aufgeführten Orientierungsleitlinien für die Unternehmensführung fordern Vorstand und Aufsichtsrat auf, die angesprochenen Sozial- und Umweltaspekte bei strategischen wie operativen Entscheidungen „im Interesse des Unternehmens“ zu erkennen und zu adressieren. Die Unternehmung wird gewissermaßen als Corporate Citizen verstanden, dessen Führungsorgane nicht auch zuletzt den Ansprüchen der „Gesellschaft“ zu genügen haben, die einen eigenständigen Stakeholder neben den anderen Bezugsgruppen repräsentiert.40 Nachhaltige Wertschöpfung setzt daher voraus, den Belangen jeder Stakeholdergruppe in angemessener Weise Rechnung zu tragen, um so die notwendige Teilnahme aller Bezugsgruppen am Wertschöpfungsprozess auch für die Zukunft sicherzustellen.41
Nach der Kodexsystematik ist an eine Berücksichtigung der in der Präambel aufgeführten Nachhaltigkeitsleitlinien indes keine besondere Befolgungs- oder Erklärungspflicht geknüpft. Börsennotierte Gesellschaften haben sich insoweit also nach § 161 AktG bislang nicht gesondert zu einer nachhaltigen Strategiefestlegung sowie zu einer sonstigen nachhaltig ausgerichteten Unternehmensleitung und -überwachung zu erklären.
3.3.2. Integration von Nachhaltigkeitsaspekten in Unternehmensstrategie, -planung und internem Kontroll- und Risikomanagementsystem
Mit der Kodexreform 2022 wird erstmalig eine Umsetzung dieser gesellschaftlichen Orientierungsleitlinien in verschiedenen Empfehlungen zu den Geschäftsführungsaufgaben des Vorstands aufgenommen und konkretisiert.
Einerseits soll nun nach Empfehlung A.1 der Vorstand die mit den Sozial- und Umweltfaktoren verbundenen Risiken und Unternehmenschancen sowie die ökologischen und sozialen Auswirkungen der Unternehmenstätigkeit systematisch identifizieren und bewerten. Daneben sollen in der Unternehmensstrategie neben den langfristigen wirtschaftlichen Zielen auch ökologische und soziale Ziele des Unternehmens angemessen berücksichtigt werden. Die Unternehmensplanung soll zudem neben finanziellen Zielen auch nachhaltigkeitsbezogene Ziele aufweisen. Flankierend hierzu soll nun nach Empfehlung A.3 das interne Kontroll- und Risikomanagementsystem sowohl auf finanzielle als auch auf nachhaltigkeitsbezogene Belange ausgerichtet sein, um eine umfassende Unternehmenssteuerung und Erfolgskontrolle zur Umsetzung einer nachhaltigen Unternehmensstrategie zu ermöglichen.42
Empfehlung A.1 konkretisiert damit den Stakeholder-Ansatz: Gute und verantwortungsvolle Unternehmensführung setzt nun explizit die Verfolgung auch nachhaltigkeitsbezogener Ziele innerhalb der Unternehmensplanung als auch den Ausgleich von Ökonomie, Ökologie und Sozialem innerhalb der Unternehmensstrategie voraus. Letztlich sind die Auswirkungen der Nachhaltigkeitsfaktoren auf das Unternehmen ebenso wie die ökologischen und sozialen Auswirkungen der Unternehmenstätigkeit nach den Methoden des Risikomanagements zu erfassen.43
3.3.3. Kontrolle nachhaltiger Unternehmensführung
Um die beabsichtigte Transformation zu einem nachhaltigeren Wirtschaftssystem tatsächlich zu realisieren, bedarf schließlich eine nachhaltige Unternehmensführung in der Aktiengesellschaft einer korrespondierenden und funktionierenden Kontrolle. Die Entwicklung und Umsetzung einer nachhaltigen Unternehmensstrategie muss daher effizient durch den Aufsichtsrat kontrolliert werden. Aus diesem Grund werden mit der Kodexreform 2022 zugleich die dem Vorstand empfohlenen Nachhaltigkeitsvorgaben mit Empfehlung A.6 auf den Aufsichtsrat zur Kontrolle übertragen. Dabei soll der Aufsichtsrat überwachen, wie die ökologische und soziale Nachhaltigkeit bei der strategischen Ausrichtung des Unternehmens und der Umsetzung berücksichtigt wird, und zudem, ob strategische und operative Pläne finanzielle und nachhaltigkeitsbezogene Ziele umfassen. Weiterhin soll der Aufsichtsrat überwachen, dass das interne Kontroll- und Risikomanagementsystem auch auf nachhaltige Belange ausgerichtet ist.
Eine funktionierende Kontrolle erfordert daneben entsprechende Kenntnisse der Aufsichtsratsmitglieder:44 Das zu erstellende Kompetenzprofil für den Aufsichtsrat als Gesamtgremium soll daher nun nach der ergänzten Empfehlung C.1 auch Expertise zu den für das Unternehmen bedeutsamen Nachhaltigkeitsfragen berücksichtigen. Dies soll gewährleisten, dass der Aufsichtsrat mit Personen besetzt wird, die den nachhaltigkeitsbezogenen Prüfungsaufgaben auch mit eigenem Sachverstand begegnen können. Zudem fordert nun die neu ergänzte Empfehlung D.4, dass der Vorsitzende des Prüfungsausschusses sowie zusätzlich ein weiteres Mitglied auch über besondere Kenntnisse in der Anwendung der Nachhaltigkeitsberichtserstattung oder der Prüfung der Nachhaltigkeitsberichterstattung verfügen sollen. Um eine erhöhte Transparenz über die tatsächlich vorhandenen Kompetenzen im Prüfungsausschuss zu erhalten, soll der Aufsichtsrat in der Erklärung zur Unternehmensführung nähere Angaben zu den besonderen Kenntnissen und Erfahrungen der betreffenden Ausschussmitglieder auf den genannten Gebieten machen.
3.3.4. Vergütungsanreize für eine nachhaltige Unternehmenspolitik
Die verantwortungsvolle und angemessene Ausgestaltung der Vorstandsvergütung ist seit jeher ein Dauerbrenner der Corporate Governance-Diskussion.45 Mit der Vorstandsvergütung gilt es insbesondere, die richtigen Anreize für das Vorstandshandeln zu schaffen, auf die gesellschaftliche Akzeptanz zu achten und klar und verständlich zu erklären, wieviel das einzelne Vorstandsmitglied erhält und wofür die Vergütung erfolgt.46 Der Kodex enthält hierzu trotz der nun mit dem ARUG II in das Aktiengesetz aufgenommenen detaillierten Regelungen zahlreiche Vorgaben zur Vergütung des Vorstands. Zu fragen ist dabei, ob und inwieweit die Kodexvorgaben Anreize für eine nachhaltige Unternehmensführung durch eine nachhaltig ausgerichtete Vorstandsvergütung vorsehen oder aufdecken.
3.3.4.1. Nachhaltige und langfristige Ausrichtung der Vergütungsstruktur
Einerseits gibt der Kodex in Grundsatz 24 Abs. 3 die gesetzlichen Vorgaben von § 87 Abs. 1 Satz 2 AktG n.F.47 wieder. Dies betont, dass der Aufsichtsrat die Vergütungsstruktur des Vorstands auf eine nachhaltige und langfristige Entwicklung der Gesellschaft auszurichten hat.48 Zugleich weist der Kodex darauf hin, dass die Vergütung zur Förderung der Geschäftsstrategie und zur langfristigen Entwicklung der Gesellschaft beizutragen hat. So wird die Funktion der Vorstandsvergütung als Instrument der Verhaltenssteuerung hervorgehoben: Der Aufsichtsrat hat also die Ausgestaltung der Vergütung (auch) als Instrument zur Sicherstellung einer nachhaltigen Unternehmensführung einzusetzen und bei der Vergütungsfestsetzung neben ökonomischen Kriterien auch soziale und ökologische Aspekte zu beachten.49 Da es sich um einen das Gesetz wiedergebenden Grundsatz handelt, ist indes hieran keine besondere Erklärungspflicht geknüpft.50
3.3.4.2. Nachhaltige Ausrichtung des Vergütungssystems
Soweit das Vergütungssystem an Nachhaltigkeitskriterien ausgerichtet ist, wird dies durch die aktuellen Kodexempfehlungen nur in Bruchteilen aufgedeckt.
Im vom Aufsichtsrat zu beschließenden Vergütungssystem soll nach der neu eingefügten Empfehlung G. 1 insbesondere festgelegt werden, welche finanziellen und nichtfinanziellen Leistungskriterien für die Gewährung variabler Vergütungsbestandteile maßgeblich sind. Solche nichtfinanziellen Leistungskriterien können etwa ökologische und soziale Faktoren sowie angestrebte Aspekte der Unternehmensführung (z.B. Erzielung einer höheren Quote an weiblichen Führungskräften, Reduzierung von Umweltbelastungen bei der Produktion etc.) darstellen.51 Dass überhaupt nichtfinanzielle Leistungskriterien für das Vergütungssystem aufgestellt werden, empfiehlt der Kodex jedoch hiermit nicht.52 Um der Empfehlung zu genügen, können also auch ausschließlich finanzielle Leistungskriterien festgelegt werden. Eine unterlassene Berücksichtigung nichtfinanzieller Leistungskriterien in Form von beispielsweise ökologisch und sozial nachhaltigen Leistungskriterien wird folglich nicht allein über die Entsprechenserklärung zu Empfehlung G.1 aufgedeckt, wohl aber mittelbar im Zusammenspiel mit dem nach § 120a AktG zu veröffentlichenden Vergütungssystem: bei einer positiven Entsprechenserklärung zu G.1 hat dieses nämlich etwaig festgelegte nichtfinanzielle Leistungskriterien auszuweisen. Sind derartige Kriterien nicht angegeben, erkennt der Interessent, dass im Vergütungssystem nichtfinanzielle Vergütungsanreize eben nicht festgelegt wurden. Werden hingegen nichtfinanzielle Leistungskriterien ausgewiesen, ist der hiermit verbundene Erkenntnisgewinn indes möglicherweise gering. Aufgrund einer nicht vereinheitlichten Darstellungsweise lässt sich deren Gewichtung im Verhältnis zu finanziellen Leistungskriterien im jeweils veröffentlichten Vergütungssystem nämlich ggf. nicht ableiten, was Greenwashing-Praktiken ermöglichen dürfte.
Etwas anderes ergibt sich auch nicht daraus, dass nach Empfehlung G.1 im Vergütungssystem zugleich festgelegt werden soll, welchen relativen Anteil die Festvergütung einerseits sowie kurzfristig variable und langfristig variable Vergütungsbestandteile andererseits an der Ziel-Gesamtvergütung haben. Wird die Empfehlung insgesamt befolgt, werden die entsprechenden Angaben zwar im zu publizierenden Vergütungssystem ausgewiesen. Die damit transparente Gewichtung langfristig variabler Vergütungsbestandteile in Verbindung mit den ebenso für die variable Vergütung festzulegenden finanziellen und nichtfinanziellen Leistungskriterien lassen dann im Vergütungssystem jedoch lediglich erkennen, ob und inwieweit an dieser Stelle der Aufsichtsrat durch eine langfristig (d.h. im Wesentlichen mehrperiodisch) ausgerichtete Vergütungspolitik Anreize für ein langfristig orientiertes Vorstandshandeln setzt. Ob und inwieweit hiermit eine solche ggf. überwiegend langfristig ausgerichtete Vergütungspolitik auch ökologische und/oder sozial nachhaltige Anreize festsetzt, lässt sich hieraus hingegen nicht ablesen.
3.3.4.3. Nachhaltige Ausrichtung der individuellen Zielvergütung
Auch eine partiell an Nachhaltigkeitskriterien ausgerichtete individuelle Zielvergütung wird durch die Kodexempfehlungen nicht aufgedeckt.
Bei der Festlegung der individuellen konkreten Zielvergütung für das bevorstehende Geschäftsjahr sollen für jedes Vorstandsmitglied nach Empfehlung G.7 für alle variablen Vergütungsbestandteile die Leistungskriterien festlegt werden, die sich – neben operativen – vor allem an strategischen Zielsetzungen orientieren sollen. Die Strategie eines Unternehmens kann dabei nachhaltige Zielsetzungen verfolgen, muss dies aber natürlich nicht: Auch wenn die Präambel des Kodex klarstellend als Leitbild vorgibt, dass Vorstand und Aufsichtsrat für eine nachhaltige Wertschöpfung des Unternehmens zu sorgen und bei der Festlegung der Unternehmensstrategie auch soziale und ökologische Nachhaltigkeitsaspekte zu berücksichtigen haben, schließt dies eine Verfolgung kurzfristiger – nicht nachhaltiger – Zielsetzungen bei der Festlegung der Unternehmensstrategie nicht aus.53
Eine etwaige Festlegung nachhaltiger Zielsetzungen bei der individuellen Zielvergütung wird durch eine Entsprechenserklärung zu Empfehlung G.7 nicht gesondert aufgedeckt. Die Erklärung lässt nur erkennen, ob Leistungskriterien für die Erzielung einer variablen Vorstandsvergütung festgelegt werden sowie ob diese sich auch an strategischen Zielsetzungen orientieren. Anhand einer positiven Entsprechenserklärung (comply) lässt sich nicht ablesen, welche Leistungskriterien konkret festgelegt wurden, sowie ob und inwieweit die bei der individuellen konkreten Zielvergütung mit der variablen Vergütung verknüpften strategischen Zielsetzungen ökologisch, ökonomisch und/oder sozial nachhaltiger Natur sind.
Auch der nun nach § 162 Absatz 4 AktG zu veröffentlichende Vergütungsbericht, der eine Auskunft über die für jedes Vorstandsmitglied gewährte und geschuldete Vergütung für das vergangene Geschäftsjahr ausweist und dabei insbesondere klar und verständlich zu erläutern hat, wie die gewählten festen und variablen Vergütungsbestandteile die langfristige Entwicklung der Gesellschaft fördern (§ 162 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 AktG), lässt durch die reine Anknüpfung an die langfristige Gesellschaftsentwicklung nicht erkennen, ob und inwiefern vergütungsbezogene Anreize für eine sozial und ökologisch nachhaltige Unternehmensführung gesetzt worden sind.
3.3.4.4. Überwiegender Anteil von langfristig variablen Vergütungsbestandteilen
Bei der Festsetzung der Höhe der variablen Vergütungsbestandteile soll nach Empfehlung G. 6 die variable Vergütung, die sich aus dem Erreichen langfristig orientierter Ziele ergibt, den Anteil aus kurzfristig orientierten Zielen übersteigen. Insofern empfiehlt der Kodex an dieser Stelle zugleich, dass variable Vergütungsbestandteile (zumindest auch) an langfristige Zielsetzungen geknüpft werden. Eine nachträgliche Änderung der Zielwerte oder Vergleichsparameter – beispielsweise kurz vor der Festsetzung – soll ausgeschlossen sein (Empfehlung G.8). Die Zielerreichung soll dabei dem Grunde und der Höhe nach nachvollziehbar sein (Empfehlung G.9).
Langfristig orientierte Unternehmensziele können ökonomischer, ökologischer und/oder sozial nachhaltiger Natur sein. Eine positive Entsprechenserklärung zu Empfehlung G.6 lässt damit nur erkennen, dass der Aufsichtsrat die variable Vergütung des Vorstands überhaupt an langfristige (oder mehrperiodische) Zielsetzungen gekoppelt hat und dass die Vergütungsgestaltung der Erreichung dieser langfristigen Ziele einen Vorrang einräumt; ob er damit (zumindest auch) nachhaltig ökologische oder soziale Zielsetzungen verknüpft, lässt sich indes aus der Erklärung nicht ablesen. Damit vermag die Erklärung zu Empfehlung G.6 keine Auskunft darüber zu geben, ob bei der Ausgestaltung der variablen Vergütung maßgebliche Anreize für die Verfolgung einer ökologisch und/oder sozial nachhaltigen Unternehmenspolitik gesetzt wurden.
4. Kritische Würdigung und Regulierungsausblick
4.1. Kritische Würdigung
4.1.1. Vorgaben des AktG
In das AktG werden durch das ARUG II erstmals verstärkt Nachhaltigkeitsaspekte eingefügt. Dies geschieht in einer eher sanften Form, wonach – nach derzeitiger Rechtslage – die Beachtung solcher Aspekte weder zwingend vorgeschrieben ist noch die Nichtbeachtung zu einer Haftung von Vorstand und/oder Aufsichtsrat führt. Anreize werden lediglich über das Vergütungssystem gesetzt. Aber auch diesbezüglich werden keine zwingenden Regelungen getroffen, in welchem Verhältnis Nachhaltigkeitskriterien zu anderen Vergütungskriterien bei der Bestimmung der Höhe der Vergütung stehen müssen.
Als korrektives Element wird der rechtliche Leitungsrahmen für die Leitung und Überwachung der Aktiengesellschaft dahingehend abgeändert, dass nun die Hauptversammlung zum einen stärkeren faktischen Einfluss auf die Vergütung des Vorstands und damit auf die Leitung der Aktiengesellschaft hat, indem sie mindestens alle 4 Jahre über das Vergütungssystem sowie über den neu eingeführten Vergütungsbericht mit beratender Wirkung abstimmen muss. Daneben kommt der Hauptversammlung nach § 87 Abs. 4 AktG nun zugleich ein rechtlicher Einfluss auf die Vergütung des Vorstands zu, indem sie die im Vergütungssystem festzulegende Maximalvergütung des Vorstands verbindlich reduzieren kann.
Des Weiteren ist zu beachten, dass über Spezialgesetze, insb. das LkSG, immer weitergehende Nachhaltigkeitspflichten entstehen, welche insgesamt schon so weitreichend sind, dass eine Übertragung ins AktG als allgemeine Nachhaltigkeitspflicht in Erwägung gezogen werden könnte.
4.2. Nichtfinanzielle Berichterstattung
Somit lässt sich feststellen, dass das AktG keine allgemeinen Nachhaltigkeitspflichten vorsieht, diese aber über spezialgesetzliche Regelungen immer relevanter werden. Bisher wurde versucht, einen ausreichenden Innovationsdruck über weitgehende Berichtspflichten aufzubauen. Diese ergeben sich nur im geringen Maße aus dem DCGK und im erheblichen Umfang aus den Pflichten zur nicht-finanziellen Berichterstattung aus der CSR-Richtlinie. Dies nimmt mit der CSR-Richtlinie 2.0 noch zu, da nun der Aufsichtsrat nicht nur formell, sondern auch inhaltlich prüfen muss, ob sachgerechte Nachhaltigkeitsberichte vorliegen. Da diese Berichtspflichten aber zu vage sind und auch am Markt wohl nicht ausreichend verfolgt werden, ist dies allein nicht ausreichend.
Unklar bleibt allerdings, inwiefern die spezifischen Nachhaltigkeitsziele im Rahmen des Vergütungssystems i.S.d. § 87 AktG und Vergütungsberichts nach § 162 AktG auch mit den nichtfinanziellen Leistungsindikatoren im Lagebericht nach § 289 Abs. 3 HGB sowie mit der nichtfinanziellen Erklärung nach § 289c Abs. 3 Nr. 5 HGB übereinstimmen. Sollte dies nicht der Fall sein, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die CSR-Leistungsziele in der Vorstandsvergütung nicht steuerungsrelevant sind und keine strategischen und operativen Transformationsprozesse auslösen. Vielmehr würde hierbei das Risiko eines „Green-“ bzw. „CSR-Washings“ im Vergütungsbericht bestehen.54
4.2.1. DCGK
4.2.1.1. Empfehlung zur Integration von Nachhaltigkeitszielen
Zumindest theoretisch gibt die Entsprechenserklärung zu Empfehlung A.1 zukünftig erstmalig Aufschluss darüber, ob die unterworfenen Gesellschaften die im DCGK enthaltenen Vorgaben zur Entwicklung und Umsetzung eines nachhaltigen wirtschaftlichen Handelns umsetzen oder nicht. Der Anreiz, dieser Empfehlung zu entsprechen, dürfte erneut „Greenwashing“-Praktiken begünstigen, die im Falle einer positiven Entsprechenserklärung das tatsächliche Ausmaß eines reflektierten nachhaltigen wirtschaftlichen Handelns nicht erkennen lassen.
4.2.1.2. Kontrolle nachhaltiger Unternehmensführung
Mit Empfehlung A.6 wird eine Transparenz darüber hergestellt, ob in einer dem DCGK unterworfenen Aktiengesellschaft die Voraussetzungen für eine effiziente Kontrolle einer nachhaltigen Unternehmenspolitik durch den Aufsichtsrat geschaffen worden sind. Ob eine solche Nachhaltigkeitskontrolle effektiv oder effizient tatsächlich stattfindet, lässt sich hieraus freilich nicht ablesen.
4.2.1.3. Vergütungsanreize für eine nachhaltige Unternehmenspolitik
Infolge der signifikanten Bedeutungszunahme von nachhaltigen institutionellen Investoren am Kapitalmarkt (Sustainable Investors, z.B. Pensionsfonds) in den letzten Jahren fordern diese auch in stärkerem Maße eine Integration von ESG-Aspekten in die Unternehmenssteuerung ein.55 Dabei schafft der Kodex mit seinen Empfehlungen zur Vorstandsvergütung nur im beschränkten Maße eine über die gesetzlichen Regelungen hinausgehende Transparenz über eine nachhaltig ausgestaltete variable Vergütungspolitik.
4.2.1.4. Nachhaltige Ausrichtung des Vergütungssystems
Dass überhaupt nichtfinanzielle Leistungskriterien für das Vergütungssystem aufgestellt werden, empfiehlt der Kodex nicht. Werden im Vergütungsbericht nichtfinanzielle Leistungskriterien ausgewiesen, ist der hiermit verbundene Erkenntnisgewinn indes möglicherweise gering. Aufgrund einer nicht vereinheitlichten Darstellungsweise lässt sich deren Gewichtung im Verhältnis zu finanziellen Leistungskriterien im jeweils veröffentlichten Vergütungssystem nämlich ggf. nicht ableiten, was Greenwashing-Praktiken ermöglichen dürfte.
4.3. Regulierungsausblick
Da sich die Regelung nachhaltiger Unternehmensführung noch stark in der Diskussion befindet, enthält das AktG keine zwingende Verpflichtung des Vorstands, die Aktiengesellschaft nachhaltig zu leiten. Entsprechende Anreize werden lediglich über das Vergütungssystem gesetzt.
Bislang setzt der Gesetzgeber also überwiegend auf freiwilliges Handeln, um den Unternehmen die erforderliche Flexibilität zu gewährleisten. Ein Weiterentwicklungsdruck soll insbesondere durch den Markt aufgebaut werden, indem große Aktiengesellschaften verpflichtet sind, regelmäßig Berichte zu Nachhaltigkeitsfaktoren abzugeben. Hierbei bedienen sich Unternehmen häufig externer Dienstleister; ausreichendes internes Know-how scheint noch nicht in ausreichendem Umfang gegeben zu sein. Allerdings wird man konstatieren müssen, dass die Berichtspflicht für sich allein nicht ausreichend ist, um Unternehmen zu nachhaltigerem Handeln zu motivieren.
Aus volkswirtschaftlicher Sicht stehen nun mehrere Möglichkeiten zur Verfügung. So kommen z.B. die gesetzliche Verankerung konkreter Handlungspflichten, kombiniert mit einer zivilrechtlichen Haftung, öffentlich-rechtliche Sanktionen, Besteuerung, etc. in Betracht. Während dies zwar einen starken externen Effekt hätte, wäre es auch mit einem großen Implementierungsaufwand für die Unternehmen verbunden, worunter dann auch wieder die Gesamtwirtschaft und die einzelnen Stakeholder leiden würden. Eine reine Selbstverpflichtung – wie bisher – garantiert zwar den Unternehmen eine große Flexibilität und Wettbewerbsfähigkeit, ist aber wohl nicht ausreichend.
4.3.1. Gesetzliche Definition nachhaltiger Orientierungsleitlinien u.a. im DCGK
Es liegt noch keine eindeutige gesetzliche oder richterrechtliche Definition des Nachhaltigkeitsbegriffes vor. Gemäß dem wohl herrschenden Verständnis in Politik, Wirtschaft und wissenschaftlicher Literatur umfasst der Nachhaltigkeitsbegriff wohl die Bereiche Umwelt, Soziales und Ökonomie. Hierbei wird insbesondere der Bereich Soziales weit verstanden und schließt unter anderem die Untergruppen Arbeitnehmerbelange, Menschenrechte und Korruptionsbekämpfung ein.
Es wird vorgeschlagen, den Nachhaltigkeitsbegriff gesetzlich eindeutig zu definieren.56 Handlungsgebote, egal wie ausgestaltet, sind nur sinnvoll, wenn der Gebotsadressat genau weiß, welches Handeln von ihm erwartet wird. Eine solche Nachhaltigkeitsdefinition könnte aus den folgenden Elementen bestehen:
- Umwelt,
- Soziales (inkl. Arbeitnehmerbelange, Menschenrechte und Korruptionsbekämpfung),
- Ökonomie, welche folgende Unterpunkte umfasst:
- Rentabilität der Aktiengesellschaft,
- Langfristige wirtschaftliche Stabilität der Aktiengesellschaft,
- Sachgerechte Verbindung der wirtschaftlichen Gesichtspunkte mit den Bereichen Umwelt und Soziales.
4.3.2. Finanzielle Sanktionen mangelnder Nachhaltigkeit
Da sich das Verständnis von nachhaltiger Unternehmensführung noch stark in der Entwicklung befindet, sollte derzeit von „harten“ staatlichen Maßnahmen, insbesondere von finanziellen Santionen (Haftung, Bußgelder, etc.) abgesehen werden. Stattdessen sollte den Unternehmen auch weiterhin ein gewisser Freiraum gewährt werden, um eine Diversität zu erzeugen und am Markt zu beobachten, welche Vorgehensweisen am besten sind.
Um trotzdem Unternehmen zu bewegen, sich stärker und vielleicht ernsthafter als bisher mit dem Thema Nachhaltigkeit zu befassen, sollte ein gewisser interner Druck in der Aktiengesellschaft aufgebaut werden. Ein rein externer Marktdruck, auf Grundlage von Berichtspflichten, scheint nicht ausreichend zu sein.
4.3.3. Nachhaltigkeitsexperte im Aufsichtsrat
In Betracht kommt ferner die zwingende Einsetzung eines Nachhaltigkeitsexperten im Aufsichtsrat. Da der Aufsichtsrat die Geschäftsführung des Vorstands überwacht und zugleich in der Lage ist, über die Vergütungsgestaltung und -festsetzung das Handeln des Vorstands indirekt zu steuern, würde die Etablierung eines entsprechenden Experten eine effiziente(re) Nachhaltigkeitskontrolle durch den Aufsichtsrat ermöglichen.
Da ein solcher Nachhaltigkeitsexperte unter anderem die Arbeitnehmerbelange zu vertreten hätte, wäre zu erwägen, bei mitbestimmten Gesellschaften einen der Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat durch den neu zu besetzenden Nachhaltigkeitsexperten zu ersetzen.
Dabei sollte die Pflicht zur Einsetzung eines Nachhaltigkeitsexperten im Aufsichtsrat nur für börsennotierte Aktiengesellschaften gelten. Diese verfügen in der Regel über die notwendigen finanziellen und personellen Mittel, um entsprechende Transformation sachgerecht durchführen zu können. Anhand der hieraus gewonnenen Erkenntnisse könnten später auch kleinere Aktiengesellschaften und andere Unternehmensformen einbezogen werden.
4.3.4. Angepasste Empfehlungen zur Vorstandsvergütung
Da der Kodex in seinen Empfehlungen zur Vorstandsvergütung G1., G.6, G.7 nur an langfristige, d.h. mehrperiodische sowie nur allgemein auf strategisch ausgerichtete Vergütungskomponenten anknüpft, werden sozial und ökologisch nachhaltige Anreize der Vergütungsgestaltung weder aufgedeckt noch wird hierdurch ein mittelbarer Zwang für eine entsprechende Befolgung ausgelöst.
Es könnte zwar an dieser Stelle im Kodex empfohlen werden, dass auch nichtfinanzielle Leistungskriterien bei der Ausgestaltung der variablen Vergütungsbestandteile festzulegen sind. Um einer solchen Empfehlung zu entsprechen, könnte dann jedoch auch nur ein minimaler punktueller Anreiz festgelegt werden, um der Empfehlung zu genügen. Eine Aussagekraft dahingehend, ob diese Anreize in einem maßgeblichen Umfang festgelegt wurden, wäre mit einer solchen Empfehlung nicht verbunden.
Ähnlich wie die in früheren Kodexfassungen vorgesehenen Tabellen zur Vorstandsvergütung könnte der Kodex ggf. eine Tabelle allein für Nachhaltigkeitsparameter vorgeben, die eine nachhaltige Vergütungsfestlegung im Vergütungssystem und im Vergütungsbericht nachvollziehbar und vergleichbar macht.