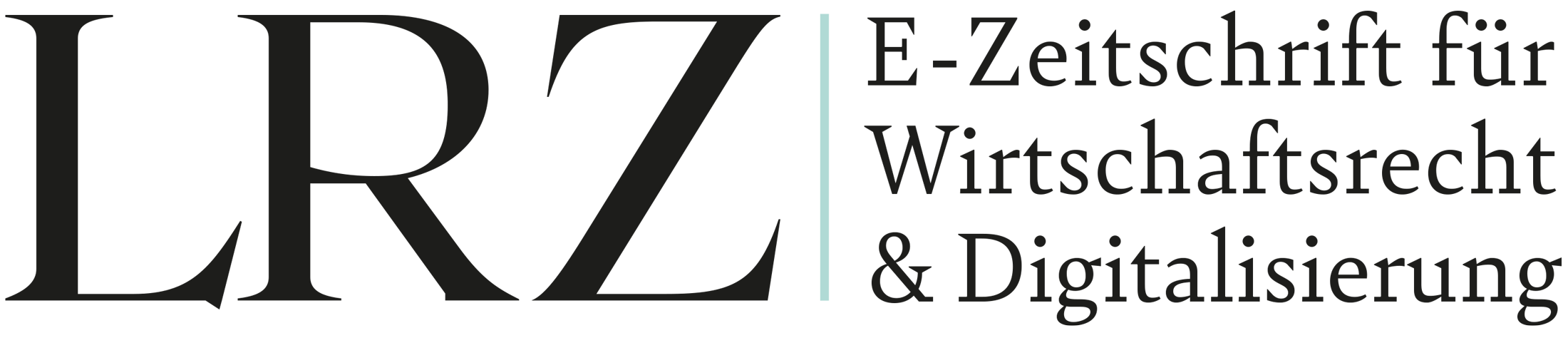Sprache auswählen

Das Sonderinsolvenzrecht der Kryptowerte
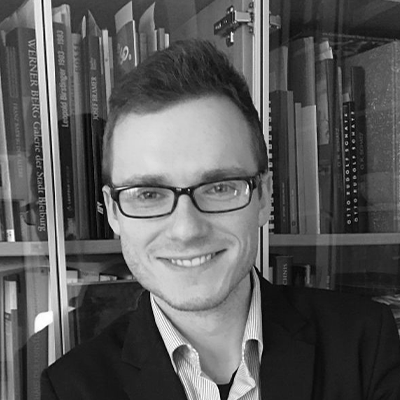
- PD Dr. Martin Miernicki
- Dozent, Institut für Recht der Wirtschaft der Universität Wien
Zitiervorschlag: Miernicki, LRZ 2024, Rn. 389, [●], www.lrz.legal/2024Rn389.
Permanente Kurz-URL: LRZ.legal/2024Rn389
In jüngster Zeit wurden auf europäischer und nationaler Ebene Vorschriften eingeführt, die spezielle insolvenzrechtliche Fragen von Kryptowerten regeln. Der vorliegende Beitrag untersucht die einschlägigen Bestimmungen der MiCAR, des KWG und des Entwurfs für das Finanzmarktdigitalisierungsgesetz, setzt diese miteinander in Bezug und unterzieht sie einer kritischen Würdigung.
1. Einführung
Kryptowerte waren in den letzten Jahren ein beliebter Gegenstand der juristischen Diskussion. Das gilt auch für deren Behandlung im Insolvenzrecht; betrachtet wurden insb. die Zugehörigkeit von Kryptowerten zur Insolvenzmasse, das etwaige Bestehen von Aussonderungs- oder Absonderungsrechten,1 das anwendbare Recht bzw. die internationale Zuständigkeit sowie Sonderfragen bei der Insolvenz von Krypto-Dienstleistern.2 Während die allgemeine insolvenzrechtliche Einordnung weiterhin relevant bleibt, haben sich in jüngster Zeit insolvenzrechtliche Sonderregelungen zu Kryptowerten entwickelt, die man als „Krypto-Insolvenzrecht“ beschreiben könnte. Der vorliegende Beitrag setzt sich mit diesem in Entwicklung befindlichen Rechtsgebiet auseinander und untersucht dessen wichtigste Bestimmungen. Dabei wird wie folgt vorgegangen: Zunächst werden die Vorgaben der MiCAR3 vorgestellt, die für die Insolvenz bei Kryptowerten besonders relevant sind. Dem folgt die Analyse der krypto-insolvenzrechtlichen Sonderbestimmungen des KWG. Schließlich wird der Entwurf des Gesetzes über die Digitalisierung des Finanzmarktes (Finanzmarktdigitalisierungsgesetz – FinmadiG)4 betrachtet.
Die gesetzgeberische Tätigkeit in Deutschland wird auch in anderen Mitgliedstaaten – so etwa Österreich – auf Interesse stoßen. Wo passend, wird daher ein Bezug zur österreichischen Rechtslage hergestellt.5
2. Krypto-Insolvenzrecht der MiCAR
2.1. Sicherungspflicht für Krypto-Dienstleister
Art. 70 Abs. 1 MiCAR verpflichtet zunächst allgemein6 Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen, die Kryptowerte von Kunden oder die Mittel für den Zugang zu solchen Kryptowerten halten, zu angemessenen Maßnahmen, um die „Eigentumsrechte“ der Kunden zu schützen und zu verhindern, dass die Kryptowerte für eigene Rechnung verwendet werden.7 Das soll insb. im Fall der Insolvenz des Dienstleisters gelten. Insofern handelt es sich um präventive Pflichten, die gerade im Insolvenzfall eine korrekte Behandlung der Kundenbestände sicherstellen sollen. Der Begriff „Eigentumsrechte“ ist autonom auszulegen8 und setzt kein Eigentumsrecht im streng sachenrechtlichen Sinn voraus; es dürften gerade die bei der Kryptoverwahrung üblichen Modelle gemeint sein, bei denen den Kunden wirtschaftliches Eigentum (nach nationalem Verständnis im Rahmen einer Treuhand)9 zukommt. Der Wortlaut umfasst aber auch Fälle, in denen die Kunden tatsächlich zivilrechtliches Eigentum an den Kryptowerten haben sollten, so wie dies etwa nach dem österreichischen Recht (§§ 353 ff öABGB) möglich wäre.10 Damit ist ein wesentlicher Punkt angesprochen: Die MiCAR gibt hier keine sachen-, schuld- oder insolvenzrechtliche Einordnung von Kryptowerten vor, vielmehr setzt sie an der jeweils anwendbaren Rechtsordnung an. Anders gesagt: Ob und in welchem Umfang „Eigentumsrechte“ der Kunden bestehen (z.B. zivilrechtliches Eigentum, Stellung eines Treugebers), ergibt sich aus den jeweiligen nationalen Rechtsordnungen und nicht aus Art. 70 Abs. 1 MiCAR. Auch wenn die Bestimmung davon ausgeht, dass i.d.R. Aussonderungsrechte an Kryptowerten bestehen werden, so richtet sich auch diese Frage nach dem insofern autonomen Recht der Mitgliedstaaten.11 Ein Beispiel stellt das Kommissionsgeschäft dar,12 bei dem die aufsichtsrechtliche Bestimmung des Art. 70 Abs. 1 MiCAR in der Insolvenz eines Krypto-Kommissionärs nicht etwa die Anwendung der § 392 Abs. 2 HGB, § 392 Abs. 2 öUGB prädeterminieren wird.13 Dass die Mitgliedstaaten hier nicht verpflichtet werden, allgemein „Eigentumsrechte“ bei der Einschaltung von Krypto-Dienstleistern einzuführen, ergibt sich auch aus der deutlich an den Dienstleister gerichteten Formulierung der Bestimmung.
Art. 70 Abs. 1 MiCAR ist in Titel V, Kapitel 2 (Art. 66 ff. MiCAR) zu den Pflichten für alle Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen verortet. Praktisch stellt sich die Frage, welche anderen Krypto-Dienstleistungen als die „Kryptoverwahrung“ (Art. 3 Abs. 1. Nr. 6 lit. a MiCAR) unter die Norm fallen könnten; tatsächlich ist die Wendung „Mittel für den Zugang zu solchen Kryptowerten“ auch unmittelbar dem genannten Tatbestand entnommen. Wohl kommen solche Fälle in Frage, in denen der Krypto-Dienstleister nur i.Z.m. anderen Dienstleistungen14 Zugriff auf den privaten Schlüssel der Kunden erhält und keine „sichere“ Aufbewahrung/Kontrolle des privaten Schlüssels oder anderer Zugangsmittel als eigene Dienstleistung verspricht.
2.2. Trennungspflicht für Kryptoverwahrer
Die allgemeine Sicherungspflicht setzt sich in einer speziellen Trennungspflicht für Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen, die Kryptowerte für Kunden verwahren oder verwalten, fort. Die Eigenbestände an Kryptowerten sind von den Kundenbeständen zu trennen und die Mittel für den Zugang zu diesen Beständen eindeutig als solche zu kennzeichnen (Art. 75 Abs. 7 U.A. 1 S. 1 MiCAR). Die Trennungspflicht gilt auch on chain (Art. 75 Abs. 7 U.A. 1 S. 2 MiCAR), die Eigenbestände müssen also anderen Netzwerkadressen als jene der Kunden zugewiesen sein.15 Art. 75 Abs. 7 U.A. 3 MiCAR sieht darüber hinaus eine „operative“ Trennung des Eigenvermögens von den verwahrten Kryptowerten vor.16
2.3. Teilharmonisierung des Insolvenzrechts bei der Kryptoverwahrung
Die organisatorischen Trennungsmaßnahmen17 werden durch eine folgenreiche Bestimmung ergänzt:18 Die vom Dienstleister verwahrten Kryptowerten sollen im Einklang mit dem geltenden (nationalen) Recht im Interesse der Kunden auch rechtlich vom Vermögen des Dienstleisters getrennt werden, sodass dessen Gläubiger – insb. im Insolvenzfall – nicht auf diese zugreifen können (Art. 75 Abs. 7 U.A. 2 MiCAR). Klar ist, dass man hier an Aussonderungsrechte der Kunden denken wird.19 Die Bestimmung führt allerdings nicht unmittelbar aus, was damit genau gemeint ist. In systematischer Interpretation müsste es sich hier um Pflichten handeln, die den Krypto-Dienstleister treffen, dieser hat aber an sich keine Möglichkeit, Aussonderungsrechte der Kunden zu „schaffen“. Denkbar wäre nur eine Auslegung, die die Passage als Auftrag an die Vertragsgestaltung des Dienstleisters versteht. Das Geschäftsmodell der Kryptoverwahrung wäre dann so aufzubauen, dass die Kunden gegen die Ansprüche der Gläubiger des Dienstleisters geschützt sind. Das würde für das deutsche Recht etwa die Vereinbarung einer entsprechenden Treuhandabrede implizieren, für das österreichische Recht käme auch eine Besitzmittlung durch den Dienstleister in Frage,20 bei der die Kunden Eigentümer der Kryptowerte bleiben. Zwar stünde diese Auslegung im Einklang mit der – sogar durch Sanktionen abgesicherten (Art. 111 Abs. 1 lit. d MiCAR)21 – „Rechtswahlpflicht“ des Art. 75 Abs. 1 lit. g MiCAR. Dennoch blieben für Kryptoverwahrer erhebliche Unsicherheiten, denn weder die privatrechtliche Einordnung von Kryptowerten noch das entsprechende Kollisionsrecht sind international harmonisiert; letzteres könnte z.B. auch zur Anwendung des Rechts eines Drittstaats führen, zumal eine Rechtswahl im internationalen Sachenrecht i.d.R. nicht anerkannt wird.22 Den von der Norm bezweckten rechtssicheren Kundenschutz wird man so nicht erreichen können.
Es ist daher der anderen Auslegungsvariante der Vorzug zu geben, dass sich Art. 75 Abs. 7 U.A. 2 MiCAR nicht an die Dienstleister richtet, sondern einen „Auftrag“ an die Mitgliedstaaten enthält: Diese haben in der Insolvenz des Dienstleisters eine Aussonderung (oder eine äquivalente Operation) von Kryptowerten zu ermöglichen, die im Rahmen eines Kryptoverwahrgeschäfts i.S.d. MiCAR vom Dienstleister übernommen werden.23 Dies wird auch dadurch gestützt, dass Abs. 7 U.A. 2 anders als die anderen Absätze des Art. 75 MiCAR nicht unmittelbar an die Anbieter der Verwahrungsdienstleistungen adressiert ist.24 Damit enthält Art. 75 MiCAR – trotz ihrer Natur als Verordnung i.S.d. Art. 288 AEUV – eine zwischen den Pflichten der Krypto-Dienstleister „versteckte“ Harmonisierung der nationalen Krypto-Insolvenzrechte.25 Daneben betrifft die Norm aber auch den Drittwiderspruch (§ 771 f. ZPO)26 bzw. die Exszindierung (§ 37 öEO) im Zwangsvollstreckungsverfahren, weil die Insolvenz nur beispielhaft genannt wird und dort ähnliche Probleme und Interessenlagen bestehen.
Dem Wortlaut des Art. 75 Abs. 7 U.A. 2 MiCAR nach gilt der Regelungsauftrag immer dann, wenn „Kunden“ (Art. 3 Abs. 1 Nr. 39 MiCAR) Kryptowerte bei einem Dienstleister „verwahren“. Die Mitgliedstaaten werden daher die Vermögenswerte von Kunden immer dann vor dem Zugriff der Gläubiger zu schützen haben, wenn der Krypto-Dienstleister ein Geschäft abschließt, das der Definition des Art. 3 Abs. 1 Nr. 17 MiCAR entspricht. Ob diese „Verwahrung und Verwaltung von Kryptowerten für Kunden“ überhaupt vereinbart wurde und wie sie (zivil-)rechtlich einzuordnen ist, richtet sich nach dem Recht der Mitgliedstaaten,27 gleiches gilt für die rechtstechnische Trennung der Kunden- von den Dienstleister-Assets und deren Durchsetzung im Verfahrensrecht.28 Sachlich richtet sich der Regelungsauftrag nur auf Kryptowerte i.S.d. Art. 3 Abs. 1 Nr. 5 MiCAR, sodass der private Schlüssel bzw. die Blockchain-Adresse nicht zwingend selbst besonderem Schutz oder einer Zuweisung zu den Kunden unterliegen müssen.29
2.4. Teilharmonisierung des Insolvenzrechts bei der Vermögenswertreserve
Art. 39 MiCAR gibt den „Inhabern“ vermögenswertereferenzierter Token (ART) gegenüber dem Emittenten und in Bezug auf das Reservevermögen das jederzeitige Recht auf Rücktausch, wenn der Emittent seinen Pflichten gem. Art. 46 f. MiCAR nicht nachkommen kann.30 Die Pflicht zum Halten einer Vermögenswertreserve (Art. 3 Abs. 1 Nr. 32 MiCAR) ergibt sich aus Art. 36 MiCAR; diese wird im Interesse der ART-Inhaber nach geltendem (nationalen) Recht vom Vermögen des Emittenten und von der Vermögenswertreserve anderer ART in einer Weise rechtlich getrennt,31 dass die Gläubiger des Emittenten, gerade bei der Insolvenz, keinen Zugriff auf die Vermögenswerte haben (Art. 36 Abs. 2 MiCAR). Schon in der Formulierung sind die Parallelen zu Art. 75 MiCAR deutlich;32 es wird daher wiederum von ein „Regelungsauftrag“ an die Mitgliedstaaten auszugehen sein, dass im nationalen Recht insb. für den Fall der Insolvenz des Emittenten eine Absicherung der Kunden vorgesehen ist. Insofern hätten die Mitgliedstaaten sicherzustellen, dass den Kunden eine „insolvenzfeste“ Rechtsposition, mithin – in nationaler Terminologie – Aussonderungsrechte an der Vermögenswertreserve, zukommt.33 Dafür spreche einerseits, dass Art. 47 Abs. 2 U.A. 2 MiCAR zur Durchführung des Rücktauschplans34 den „Verwalter“ (und nicht den Insolvenzverwalter) zuständig macht; damit könne es sich nur schwerlich um Absonderungsrechte handeln.35 Andererseits sei aus der Trennungspflicht (Art. 36 Abs. 2 f. MiCAR) und dem Rücktauschrecht (Art. 39 Abs. 1 Alt. 2 MiCAR) zu folgern, dass die Vermögenswertreserve keinen Teil der Insolvenzmasse darstellt.36
Hinsichtlich der Textierung der MiCAR ist das eine gangbares Auslegungsergebnis. Zweifel bleiben allerdings zunächst hinsichtlich des Umstands, dass der Emittent an sich „Inhaber“ der Vermögenswertreserve sein soll (im wird also die Rechtszuständigkeit zukommen),37 was eher für Absonderungsrechte streiten würde. Können die Kunden dennoch aussondern, entspräche das der Situation bei der Treuhand, sodass man die Vermögenswertreserve wohl als eine Form von Treugut begreifen könnte. Außerdem hat die Vermögenswertreserve nach der MiCAR den Zweck, die Forderung gegenüber dem Emittenten „besichern“,38 was ebenso für Absonderungsrechte spricht.39
Insgesamt dürfte die MiCAR bei der Vermögenswertreserve ein Sicherungsinteresse – und kein Sachinteresse so wie bei der Verwahrung von Kryptowerten40 – der ART-Inhaber anerkennen.41 Diese haben nämlich überhaupt keinen Einfluss darauf, welche Assets einer „rechtlichen Trennung“ gem. Art. 36 Abs. 2 MiCAR durch Zuordnung zur Vermögenswertreserve unterliegen;42 bei der Kryptoverwahrung übertragen die Kunden hingegen ihre Assets auf den Verwahrer oder schaffen Assets über diesen auf rechtsgeschäftlicher Basis an. Letztlich geht es bei der Vermögensreserve darum, Haftungsrisiken zu mildern (vgl. ErwGr 54 MiCAR), nicht aber um die bei Kryptoverwahrung hervorstechenden Herausgabe- oder Übertragungsansprüche. Das spricht dafür, dass sich der Regelungsauftrag an die Mitgliedstaaten zumindest darauf bezieht, Absonderungsrechte (nach nationalem Verständnis) einzuführen; damit bliebe die Vermögenswertreserve trotz ihrer Ausgestaltung als Sondervermögen Teil der Insolvenzmasse. Das heißt aber nicht, dass die Mitgliedstaaten das Sicherungsinteresse der ART-Inhaber rechtstechnisch nicht auch anders umsetzen könnten, etwa dadurch, dass die Vermögenswertreserve aus der Insolvenzmasse herausgenommen und einer Aussonderung bzw. einer Verwertung zugeführt wird. Der Schutz der ART-Inhaber richtet sich nämlich „nach geltendem Recht“ (Art. 36 Abs. 2 MiCAR) und überlässt den Mitgliedstaaten daher einen entsprechenden Handlungsspielraum.
3. Krypto-Insolvenzrecht des KWG
3.1. Trennungspflicht für Kryptoverwahrer
Seit 2020 ist die Kryptoverwahrung in Deutschland als erlaubnispflichtige Finanzdienstleistung in § 1 Abs. 1a Nr. 6 KWG geregelt.43 Mit dem ZuFinG wurden dem Gesetz neue Bestimmungen hinzugefügt, die insolvenzrechtliche Relevanz besitzen: So bestimmt § 26b Abs. 1 S. 1 KWG, dass Institute, die das Kryptoverwahrgeschäft erbringen, die Kryptowerte und privaten kryptographischen Schlüssel ihrer Kunden von den eigenen Kryptowerten und Schlüsseln getrennt zu verwahren haben. Das kann man mit dem für die Aussonderung in Treuhandkonstellationen grundlegenden Trennungsgrundsatz44 in Beziehung setzen,45 den das Gesetz im Kleid einer aufsichtsrechtlichen Vorgabe festschreibt.46 Eine Sonderregel für Omnibus-Wallets („gemeinschaftliche Verwahrung“) enthält § 26 Abs. 1 S. 2 KWG;47 in solchen Fällen ist sicherzustellen, dass die jeweiligen Anteile der einzelnen Kunden am Gesamtbestand jederzeit bestimmbar sind. Aus dieser Regelung ergibt sich unmittelbar, dass die ungetrennte Verwahrung von Kryptowerten der Kunden zulässig ist.48 Gem. § 26b Abs. 2 KWG hat das Institut schließlich sicherzustellen, dass über die verwahrten Kryptowerte und privaten Schlüssel der Kunden ohne ihre ausdrückliche Einwilligung nicht für eigene Rechnung des Instituts oder für Rechnung einer anderen Person verfügt werden kann.
3.2. Zuordnung verwahrter Kryptowerte
Neben der die Insolvenz des Kryptoverwahrers „flankierenden“ Regelung des § 26b KWG enthält § 46i KWG eine Kernbestimmung für das Insolvenzrecht der Kryptowerte; schon ihre Überschrift stellt den Bezug zur Aussonderung bei der Kryptoverwahrung und damit den Kunden- bzw. Anlegerschutz her. Gem. § 46i Abs. 1 S. 1 KWG gilt der im Rahmen eines Kryptoverwahrgeschäfts für einen Kunden verwahrte Kryptowert als dem Kunden „gehörig“. Klargestellt wird damit, dass dem Kunden in der Insolvenz des Kryptoverwahrers ein Aussonderungsrecht gem. § 47 InsO zusteht.49 Das gilt auch, wenn Kryptowerte gemeinschaftlich verwahrt werden und dem Kunden ein Anteil am „Sammelbestand“ zusteht (§ 46i Abs. 2 Var. 1 KWG). Bemerkenswert ist dabei, dass es sich der Grundregel des § 46i Abs. 1 S. 1 KWG zumindest ihrer Formulierung nach um eine Fiktion50 („gilt“) bzw einer unwiderleglichen Vermutung51 handelt – Kundenbestände sollen also auch dann als aussonderungsfähig betrachtet werden, wenn dies nach allgemeinen Regeln nicht der Fall wäre. Praktisch wird dies relevant, wenn die Voraussetzung der Aussonderung von Treugut nicht eingehalten sind. Tatsächlich soll § 46i KWG an den zur Treuhand entwickelten Grundsätzen anknüpfen und eine Prüfung der Voraussetzungen für die Aussonderung gerade entbehrlich machen.52 Mit diesen Voraussetzungen dürften besonders der Unmittelbarkeits- und Trennungsgrundsatz angesprochen sein.53
Unklar ist allerdings, wie sich das Aussonderungsrecht nach § 46i KWG zur Trennungspflicht nach
§ 26b KWG verhält; zumindest der Wortlaut des Gesetzes stellt keine unmittelbare Verbindung zwischen den Bestimmungen her. Insofern lässt sich vertreten, dass diese auch unabhängig voneinander anzuwenden sind. Das bedeutet in weiterer Folge, dass ein Aussonderungsrecht des Kunden auch dann besteht, wenn die Verpflichtung zur Vermögenstrennung gem. § 26b KWG nicht eingehalten wird;54 im Ergebnis gibt das den Trennungsgrundsatz für diesen Bereich auf. Die Materialien gehen hier allerdings in eine andere Richtung,55 denn diese sprechen davon, dass die allgemeinen Anforderungen für die Aussonderungen von Treugut durch die Vorgaben des § 26b Abs. 1 KWG „ersetzt“ werden sollen.56 Das der Aufsicht unterliegenden Vermögenstrennungsgebot rechtfertige es, die verwahrten Kryptowerte (und Schlüssel)57 haftungsrechtlich dem Vermögen der Kunden zuzuordnen.58 Dies deutet eher in die Richtung, dass die Aussonderungsmöglichkeit nicht besteht, wenn die Pflichten des § 26b KWG nicht beachtet werden.59 Letztlich sprechen aber die besseren Gründe für eine getrennte Anwendung der
§§ 26b, 46i KWG: Dafür streitet neben dem allgemeinen Anliegen des Kundenschutzes der Zweck des Gesetzes, auf die Prüfung der üblicherweise bestehenden Anforderungen zu verzichten, die man ja sonst über § 26b KWG in wichtigen Teilen doch wieder einführen würde.60 Außerdem sprechen die Materialien diese Bestimmung (nur) als aufsichtsrechtliche Anforderung an,61 deren Einhaltung etwaige Aussonderungsrechte der Kunden offenbar nicht prädeterminieren soll.
In der Sache geht es den Materialien auch darum, die „echte wirtschaftliche Berechtigung“ des Kunden im Rahmen der Treuhandabrede hervorzuheben und andere Konstruktionen von § 46i KWG auszuschließen.62 Diese Form der Berechtigung soll nicht bestehen, wo der Kunde seine Einwilligung zu Verfügungen über den verwahrten Wert für Rechnung des Instituts oder Dritte erteilt hat (§ 46i Abs. 1 S. 2 KWG).63 Auch wenn das Gesetz an der Treuhandschaft ansetzt, erfolgt keine nähere (zivilrechtliche) Auseinandersetzung mit Rechtsnatur der Vereinbarung oder von Kryptowerten an sich.64 Unabhängig von einer konkreten zivilrechtlichen Einordnung kommt § 46i KWG daher zur Anwendung, wenn ein Kryptoverwahrgeschäft i.S.d. KWG (§ 46 Abs. 1 S. 1 KWG) und kein Ausschluss nach § 46i Abs. 1. S. 2 KWG vorliegt.65 „Sperrwirkung“ wird § 46i KWG hinsichtlich Aussonderungsrechten allerdings nicht haben.66 Sollte ein Ausschluss nach § 46i Abs. 1. S. 2 KWG vorliegen, wären daher wohl Aussonderungsrechte nach allgemeinen Grundsätzen zumindest theoretisch nicht ausgeschlossen, so sie sich begründen ließen; das wäre im Einzelfall zu prüfen. Umgekehrt ist die Anwendung des § 46i KWG nicht deswegen ausgeschlossen, dass ein Dienstleister über keine Erlaubnis für das Kryptoverwahrgeschäft verfügt und dennoch entsprechende Dienstleistungen erbringt.67
Im Schrifttum wurden die Sonderregelungen des KWG zur Insolvenz des Kryptoverwahrers unterschiedlich gewürdigt.68 So stieß die weite Aussonderungsmöglichkeit gem. § 46i KWG auf Kritik; anders als normalerweise bei der Treuhand finde insb. der Trennungsgrundsatz keine Anwendung.69 Dass insofern Kunden von Kryptoverwahrern privilegiert werden, lässt sich nicht abstreiten, ist aber durchaus nachvollziehbar: Gerade nach einigen abschreckenden Beispielen für Insolvenzen in der Krypto-Industrie70 ist es nötig, Vertrauen in Kryptowerte und in die zusammenhängen Dienstleistungen aufzubauen; davon werden letztlich auch die verpflichteten Dienstleister profitieren. Dafür erscheint ein wirksamer Kunden- bzw. Anlegerschutz insb. bei der Kryptoverwahrung (aber auch bei neuen Assets wie Stable Coins)71 als nötig.72 Außerdem wird die weite Aussonderungsmöglichkeit nach der m.E. zutreffenden Auslegung von der MiCAR vorgegeben,73 sodass dem deutschen Gesetzgeber insofern kein Spielraum zukommt: Art. 75 Abs. 7 MiCAR nimmt nämlich keine Einschränkung der „rechtlichen“ Trennung im Sinne von Trennungs- oder auch Unmittelbarkeitsgrundsatz vor, dazu stellt die Verordnung nicht auf nationale Variationen der Treuhandschaft ab. Aus dieser Perspektive74 hat der deutsche Gesetzgeber diese Vorgabe korrekt umgesetzt. Gegen die weite Möglichkeit der Aussonderung spricht jedenfalls nicht, dass der Einbezug von Intermediären der Grundidee der Blockchain widerspricht,75 denn einerseits wird es immer Dienstleister brauchen, die weniger technisch affinen Personen den Zugang zur Technologie eröffnen und die ein Forum für den Handel mit Kryptowerten bieten. Trotzdem verspricht die Technologie große Effizienzgewinne, da z.B. längere Verwahrketten an sich nicht mehr nötig sind.76 Andererseits könnte man mit diesem Argument auch die Aussonderungsfähigkeit von sammelverwahrten Wertpapieren in Frage stellen, denn der stückelöse Effektenverkehr führt zur faktischen Bedeutungslosigkeit von Wertpapierurkunden und steht dem ursprünglichen Zweck der Verbriefung unkörperlicher Rechte in körperlichen Urkunden in ähnlicher Weise entgegen. Jedenfalls gibt die Thematik einen guten Anlass, um über die Grundlagen der Aussonderung bei der Treuhand zu diskutieren.77 Möglicherweise beobachtet man hier auch den ersten Schritt zur Eingrenzung oder vlt. sogar Aufgabe des Trennungsprinzips.78
Kritik hat außerdem die Ausnahme des § 46i Abs. 1 S. 2 KWG erfahren. Da hier anders als nach § 26b Abs. 2 KWG, der eine ausdrückliche Einwilligung verlangt, keine weiteren Vorgaben gemacht werden, könnten Unsicherheiten bestehen, ob Aussonderungsrechte zustehen.79 Ganz allgemein sei es aber in den erfassten Situationen grundsätzlich überschießend, die Aussonderungsrechte des Kunden zu verneinen.80 Letzterem ist zuzustimmen; im Anwendungsbereich der MiCAR (vgl. § 45 Abs. 1 S. 2 KMAG-E)81 stellt sich außerdem die Frage, ob die – im Referentenentwurf noch nicht enthaltene82 – Einschränkung im Einklang mit der Verordnung steht, denn in dieser Form findet man dort keine Entsprechung. Es erscheint daher möglich, dass sowohl der Tatbestand der Kryptoverwahrung gem. Art. 3 Abs. 1 Nr. 17 MiCAR als auch die Einschränkung des § 45 Abs. 1 S. 2 KMAG-E erfüllt sind, was i.V.m. Art. 75 Abs. 7 MiCAR nicht den Vorgaben der Verordnung entspricht. Eine unionskonforme Interpretation dahingehend, dass der Gesetzgeber lediglich auf den Anwendungsbereich der Kryptoverwahrung i.S.d. MiCAR verweisen möchte,83 scheitert wohl am Wortlaut. Die Bestimmung sollte daher jedenfalls im Anwendungsbereich der MiCAR überdacht werden.84
3.3. Zuordnung privater Schlüssel
Die vom Kryptoverwahrgeschäft erfassten Tätigkeiten (Verwahrung, Verwaltung und Sicherung) beziehen sich nach dem Wortlaut des § 1 Abs. 1a S. 2 Nr. 6 KWG neben Kryptowerten auch auf private kryptografische Schlüssel.85 Anknüpfend daran spricht § 46i Abs. 2. Var. 2 KWG davon,86 dass die haftungsrechtliche Zuordnung von Kryptowerten der Kunden auch für „isoliert verwahrte private kryptographische Schlüssel“ gilt. Dementsprechend werden die privaten kryptographischen Schlüssel so wie auch die Kryptowerte dem Zugriff der allgemeinen Gläubiger des Kryptoverwahrers entzogen.87 Es soll aber keine Festlegung dazu getroffen werden, ob diese Schlüssel sonderrechtsfähig sind oder ob „die Berechtigung an ihnen der Berechtigung am öffentlichen Schlüssel oder den unter diesem Schlüssel abgelegten Werten folgt“; eine entsprechende Klärung der „güter- und güterzuordnungsrechtlichen Fragen“ stehe noch aus.88
Es dürfte allerdings recht klar im Einklang mit dem herrschenden Verständnis zum deutschen Recht stehen, dass weder der private noch der öffentliche Schlüssel körperlich und somit Sachen i.S.d. § 90 BGB sind.89 Schwieriger ist hingegen das Verhältnis von privatem Schlüssel, öffentlichem Schlüssel und die durch sie kontrollierten Kryptowerten. Unterschieden werden muss zunächst das Schlüsselpaar von den Kryptowerten, denn letztere können frei auf ganz unterschiedliche bestehende oder neu geschaffene Adressen übertragen und mit entsprechenden privaten Schlüsseln kontrolliert werden. Das spiegelt auch der Tatbestand des Kryptoverwahrgeschäfts i.S.d. KWG wider: Dieses wird man so interpretieren müssen, dass eine Verwahrung des Kryptowerts dann vorliegt, wenn nur der Dienstleister Kenntnis des privaten Schlüssels besitzt; für eine separate „Verwahrung“ des privaten Schlüssels besteht dann kein Raum mehr.90 Hat der Dienstleister hingegen neben seinem Kunden Zugriff auf den privaten Schlüssel, kann von der „Kryptosicherung“ gesprochen werden.91 Das Regulierungsinteresse auch in diesen Fällen ergibt sich daraus, dass der privaten Schlüssel eine umfassende faktische Verfügungsmacht über die Kryptowerte vermittelt92 und daher auch bei zwischen Verwahrer und Kunden „geteiltem Zugang“ eine Gefahr für letzteren besteht.93 Da der Kunde den privaten Schlüssel bei der „Kryptosicherung“ folglich kennt, besteht kein unmittelbares Interesse an einer diesbezüglichen Aussonderung, die § 46i KWG aber offenbar ermöglichen möchte. Durch die Kenntnis des privaten Schlüssels kann er nämlich ohnehin unmittelbar Übertragungen vornehmen; ein Anspruch gegen den Schuldner hilft insofern nicht. Das wäre möglicherwiese nur dann anders, wenn man in das Aussonderungs- bzw. „Herausgaberecht“ ein Recht auf Löschung des privaten Schlüssels beim Dienstleister hineinträgt;94 selbst dann wäre dem Kunden aber eine baldige On-Chain-Übertragung zu empfehlen, um die Kryptowerte einer „sicheren“ Adresse zuzuweisen, bei der nur er (oder eine vertrauenswürdige dritte Person) den privaten Schlüssel kennt.
Privater und öffentlicher Schlüssel weisen einen notwendigen mathematischen Zusammenhang auf: Nach dem gängigen Erklärungsmodell wird der private Schlüssel aus einer Zufallszahl abgeleitet, der öffentliche Schlüssel aus dem privaten Schlüssel, die Blockchain-Adresse wiederum aus dem öffentlichen Schlüssel (letztere beide werden häufig überhaupt gleichgesetzt).95 Diese aus technischen Gründen untrennbare Verbindung eines konkreten Schlüssels mit einer konkreter Adresse führt dazu, dass der private Schlüssel etwa nach österreichischem Sachenrecht nicht sonderrechtsfähig ist und als unselbstständiger Bestandteil (vgl. § 294 S. 2 öABGB) der Blockchain-Adresse, die den „Zuweisungsort“ der Kryptowerte im dezentralen Netzwerk darstellt, angesehen werden kann.96 Eine Aussonderung des privaten Schlüssels alleine (unabhängig von der Adresse) kommt daher nicht in Betracht.97 Eine entsprechende Begründung kann man für das deutsche Recht – hier geht es um die Eigenschaft als wesentliche Bestandteile einer Sache gem. § 93 BGB – nur unter Schwierigkeiten führen, denn weder ist die Blockchain-Adresse eine Sache, noch ist der private Schlüssel ein (körperlicher) Bestandteil.98 Wirtschaftlich gesehen macht eine einheitliche Behandlung aber jedenfalls Sinn, denn eine Übertragung der Adresse ohne Kenntnis des privaten Schlüssels ist nicht sinnvoll möglich, umgekehrt geht mit dem privaten Schlüssel auch die Verfügungsmacht über die Adresse einher.99 Wer den privaten Schlüssel aussondert, sondert daher zugleich die Blockchain-Adresse aus.100 Fraglich ist dann aber, welches Interesse der Kunden an der separaten Aussonderung der Blockchain-Adresse (inkl. privaten Schlüssel) hat, denn diesem wird es um die Kryptowerte gehen und nicht um die Adresse, die ihm ggf. nicht einmal bekannt sein wird und für die regelmäßig relativ einfach Ersatz (durch Erstellung einer weiteren Adresse) geschaffen werden kann. Sinnvoll denkbar ist die Aussonderung einer Blockchain-Adresse von vornherein nur im Fall von Segregated Wallets.101 Selbst dann ist aber nach Aussonderung des privaten Schlüssels wiederum die Übertragung der zugewiesener Kryptowerte auf eine „sichere“ Adresse zu empfehlen. Keine Aussonderung ist im Übrigen dann möglich, wenn vereinbart wurde, dass dem Kunden keine Rechte an der Blockchain-Adresse (inkl. privatem Schlüssel) zukommen soll, denn dann ist dieser anders als von § 46i KWG gefordert nicht wirtschaftlicher Eigentümer der Blockchain-Adresse bzw. des privaten Schlüssels.
Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass das Kryptoverwahrgeschäft auch die Sicherung von privaten Schlüsseln zu Kryptowertpapieren nach dem eWpG erfasst.102 Fraglich ist, ob man solche Schlüssel dann auch gem. § 46i KWG aussondern kann. Der Wortlaut wäre hier weit genug; da die Sachfiktion des § 2 Abs. 3 eWpG für private Schlüssel nicht greift, wäre ein solche Regelungen insofern auch nicht überflüssig.103 Es fragt sich aber wie bei Kryptowerten allgemein, inwieweit hier ein Interesse nach einer Aussonderung besteht, da der Kunde den privaten Schlüssel bei der Sicherung des Schlüssels (anders als bei der Verwahrung des Kryptowerts bzw. des elektronischen Wertpapieres) ohnehin kennen müsste.
4. Krypto-Insolvenzrecht des FinmadiG-Entwurfs
Die Bestimmungen des KWG stehen bedingt durch die MiCAR vor einer Reform, die im Rahmen des Entwurfs zum FinmadiG vorgeschlagen wurde.104 Damit soll ein neues Kryptomärkteaufsichtsgesetz (KMAG) eingeführt und die nötigen Änderungen des KWG umgesetzt werden. Das Kryptoverwahrgeschäft wird nunmehr zum „qualifizierten Kryptoverwahrgeschäft“ und soll sich auf „kryptografische Instrumente“ beziehen;105 explizit ausgenommen sind dabei neben E-Geld und elektronischen Wertpapieren insb. Kryptowerte i.S.v. Art. 3 Abs. 1 Nr. 5 MiCAR. Dadurch wird das qualifizierte Kryptoverwahrgeschäft im Verhältnis zur MiCAR zu einem Auffangtatbestand,106 der jene Fälle erfassen soll, die bisher unter die Definition fielen und auch nicht der Verordnung unterliegen;107 in der Sache geht es um MiFID-II-Finanzinstrumente, soweit diese keine elektronischen Wertpapiere nach dem eWpG sind, und entsprechende private Schlüssel.108 Hintergrund ist, dass deren „Verwahrung“ wohl durch das aufsichtsrechtliche Netz fallen würde, denn das Depotgeschäft gem. § 1 Abs. 1 S. 2 Nr. 5 KWG kommt an sich nur auf Wertpapiere (i.V.m. § 2 eWpG auch elektronische) als vertretbare Sachen (§ 1 Abs. 1 DepotG, § 91 BGB) zur Anwendung, was Kryptowerte allgemein ausschließt.109 Vor diesem Hintergrund erscheint eine Aufrechterhaltung des qualifizierten Kryptoverwahrgeschäfts erwartbar, auch wenn die Zweckmäßigkeit einer solchen Regelungen bezweifelt wird.110 Soweit zwischen der Verwahrung physischer Wertpapiere und der Verwahrung des Finanzinstrumente-Kryptowertes (bzw. des privaten Schlüssels) wegen der unmittelbaren Zugriffsmacht des Dienstleisters – mit entsprechenden Gefahren für den Kunden – funktionelle Ähnlichkeit besteht, kann man allerdings umgekehrt auch fragen, weshalb nicht beide Situationen gleichbehandelt werden.111 Gewissermaßen tritt auch die bereits angesprochene Sonderbehandlung von Krypto-Anlegern erneut zu Tage, da § 46i KWG (diesmal ohne unionsrechtlichen Zwang) nur auf das qualifizierte Kryptoverwahrgeschäft, nicht aber auf die reguläre Verwahrung anwendbar ist.112 Utility Token bleiben im Übrigen von der Definition kryptografischer Instrumente ausgenommen.113 Deutlicher als bisher tritt in der vorgeschlagenen Fassung schließlich hervor, dass sich die „Verwahrung“ und die „Verwaltung“ auf kryptografische Instrumente und die „Sicherung“ auf kryptografische Schlüssel beziehen, was aus Gründen der Rechtsklarheit zu begrüßen ist. Die §§ 26b, 46i KWG werden an die neuen Regelungen angepasst, ohne dass sich ansonsten Abweichungen von der bisherigen Rechtslage ergeben.114 Insofern bleiben auch die oben geschilderten Fragen i.Z.m. der Aussonderung des privaten Schlüssels bestehen.
§ 45 KMAG-E wird dem aktuellen § 46i KWG nachgebildet und soll die Vorgaben von Art. 75 Abs. 1 MiCAR umsetzen.115 Naturgemäß bezieht sich die Bestimmung daher nicht auf das Kryptoverwahrgeschäft nach dem KWG, sondern auf Kryptowerte (§ 2 Abs. 1 KMAG-E) und die Kryptoverwahrung (§ 2 Abs. 11 KMAG-E) i.S.d. MiCAR. Ansonsten bleiben die wesentlichen aus der geltenden Rechtslage bekannten Strukturen mit den oben aufgezeigten Problemen erhalten. § 26b KWG wurde nicht separat übernommen, da sich Entsprechendes ohnehin aus Art. 75 Abs. 7 MiCAR ergebe.116 Weitere (dem § 46b KWG entsprechende)117 Maßnahmen beziehen sich auf „Institute“ (§ 2 Abs. 4 KMAG-E – Emittenten von ART und EMT sowie Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen), einem „Oberbegriff“ zu Tätigkeiten, die einem Zulassungs- bzw. Erlaubnisvorbehalt unterliegen.118
Im Hinblick auf die Vermögenswertreserve wird – zur Durchführung der Art. 36, 54 MiCAR119 – vorgesehen, dass der Emittent in einem Rücktauschplan den Abwickler benennt, der im Falle der Durchführung des Rücktauschplans zu bestellen ist (§ 28 Abs. 1 S. 1 KMAG-E). Hauptaufgabe des Abwicklers sind die Verwertung des Reservevermögens und die verhältnismäßige Auskehr des Erlöses (abzüglich Auslagen und Verfügung) an die Berechtigten aus dem Rücktauschplan (§ 28 Abs. 5 S. 3 KMAG-E). Die insolvenzrechtlich zentrale Weichenstellung nimmt § 28 Abs. 8 S. 1 KMAG-E vor, nach dem das Reservevermögen im Insolvenzfall des Emittenten nicht in die Insolvenzmasse fällt. Sollten ART-Inhaber keine vollständige Befriedigung durch Erlösauskehr gem. Abs. 5 erhalten, können sie anteilsmäßige Befriedigung aus der Insolvenzmasse verlangen (§ 28 Abs. 8 S. 2 KMAG-E), umgekehrt sind etwaige Vermögenswerte, die nach Durchführung des Rücktauschplans verbleiben, an die Masse herauszugeben. Wie oben dargestellt, sollten diese Regelungen den Vorgaben der MiCAR entsprechen; die Formulierung des Art. 36 Abs. 2 MiCAR, dass die Gläubiger des Emittenten „keinen Zugriff auf die Vermögenswertreserve“ haben, wird nicht so auszulegen sein, dass überschüssige Erlöse nicht an die Masse (und damit letztlich an sich auch an die übrigen Gläubiger) herausgegeben werden dürften. Freilich wird mit der vorgeschlagenen Regelung des KMAG gewissermaßen ein Hybrid zwischen Aus- und Absonderungsrecht geschaffen, denn die fehlende Zugehörigkeit zur Masse spricht für die Aussonderung (vgl. § 47 InsO), die Herausgabe der überschüssigen Erlöse an die Masse für die Absonderung (vgl. § 170 InsO), gleiches gilt für den im umgekehrten Fall (keine ausreichende Erlöse) vorgesehenen Ausfallsgrundsatz (vgl. § 52 InsO).120 Insgesamt scheint das Reservevermögen gem. § 28 Abs. 8 S. 2 KMAG-E daher durchaus ein „Vorzugsrechts trotz haftungsrechtlicher Zuordnung zur Masse“ 121 zu installieren, was typologischer eher dem Bereich der Absonderungsrechte entspricht. Obwohl die MiCAR für den Rücktauschplan einen „vorläufigen Verwalter“ vorsieht (vgl. § 28 Abs. 3-7 KMAG-E: „Abwickler“),122 wäre wohl grundsätzlich auch die Einordnung als Absonderungsrecht – Vermögenswertreserve als Teil der Insolvenzmasse mit besonderer Zuständigkeit des Verwalters – zulässig gewesen.
5. Fazit
Die neuen und in Planung befindlichen Bestimmungen zeigen deutlich, dass sich das noch junge „Krypto-Insolvenzrecht“ derzeit in dynamischer Weiterentwicklung befindet. Die insolvenzrechtlich relevanten Sonderbestimmungen der MiCAR sind dabei Ausdruck dafür, dass der Kunden- bzw. Anlegerschutz ein wesentliches Anliegen des europäischen Gesetzgebers ist. Dadurch mag es – je nach anwendbarem nationalem Recht – zu einer Besserstellung dieser Personen im Vergleich zu Gläubigern in „regulären“ Insolvenzverfahren kommen. Dass grundlegende Aspekte des Krypto-Insolvenzrechts von der MiCAR explizit angesprochen werden, ist aber – trotz gewisser sprachlicher Unklarheiten – zu begrüßen, denn es handelt sich immer noch um ein relativ neues Wirtschaftssegment, dessen Grundstrukturen sich noch konsolidieren müssen. Erklären lassen sich Regelungen der MiCAR freilich primär durch die – im Hinblick auf ursprüngliche Idee der Blockchain-Technologie im Grunde paradoxen123 – praktisch überragende Bedeutung von Krypto-Intermediären. In der Sache handelt es sich beim Insolvenzrecht der MiCAR dann auch um ein Insolvenzrecht der Krypto-Intermediäre (inkl. bestimmter Emittenten); wesentliche Fragen des Insolvenzrechts bleiben dagegen ungeregelt.124 So hält die MiCAR für „reguläre“ Insolvenzen keine Vorgaben bereit, sodass die Rechtordnungen der Mitgliedstaaten insoweit weiterhin zur Regelung berufen sind. Auch die angrenzende Frage nach der Anknüpfung von Kryptowerten im internationalen Sachenrecht bleibt unharmonisiert und vorerst dem nationalen Recht überlassen.125
Das komplexe Verhältnis der Spezialregulierung der MiCAR und dem nationalen Insolvenzrecht führt dazu, dass viele Bestimmungen einer Umsetzung in den Mitgliedstaaten bedürfen. Dem grundsätzlichen Verbot der Umsetzung einer Verordnung steht das deshalb nicht entgegen, weil die MiCAR an den entscheidenden Stellen auf das nationale Recht verweist, damit von einer weiteren Regelung in den nationalen Rechtsordnungen ausgeht.126 Das deutsche Recht hat gewissermaßen als „Vorreiter“127 bereits ein spezielles Krypto-Insolvenzrecht eingeführt und ist dabei, dieses an das Inkrafttreten der MiCAR anzupassen. Diese Anstrengungen sind grundsätzlich zu begrüßen und mögen auch für andere Rechtsordnungen eine Orientierung sein. Das gilt etwa für Österreich, wo Begleitbestimmungen zur MiCAR bislang nicht vorgeschlagen – geschweige denn verabschiedet – wurden.128 Das dortige Recht trifft zwar mit der expliziten Erfassung von Kryptowerten („virtuellen Währungen“) Recht der Zwangsvollstreckung (§ 326 öEO)129 wichtige Klarstellungen, doch sollten die Vorgaben der MiCAR schon der Rechtssicherheit wegen explizit umgesetzt werden. Inwieweit von den Ansätzen des deutschen Gesetzgebers abgewichen werden sollte – z.B. hinsichtlich der „Verwahrung“ privater Schlüssel oder der besonderen Regulierung eines qualifizierten Kryptoverwahrgeschäfts – ist im Rahmen einer weiteren Diskussion zu erörtern. Was Deutschland hingegen weiterhin fehlt, ist der „Unterbau“ eines Krypto-Zivilrechts.130 Die Vorschläge dazu sind so zahlreich131 wie zu bedenkenden Fragen komplex; das zeigt insb. Sachfiktion des § 2 Abs. 3 eWpG, die elektronische Wertpapiere „in das Sachenrecht holen soll“, gleichsam aber mit zahlreichen Problemen behaftet ist.132 Dagegen können bereits nach geltendem österreichischem Recht auf Grund der Flexibilität des öABGB viele zentrale Weichenstellungen sinnvoll gesetzt werden.133